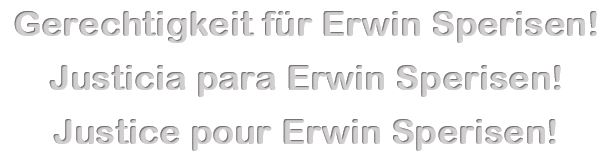Protokolle eines Justizverbrechens
Als der Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa im August 2012 ein schwer bewaffnetes Polizeikommando losschickte, um Erwin Sperisen festzunehmen, war er davon überzeugt, einen Verbrecher ins Gefängnis zu stecken. Bald muss Bertossa allerdings erkannt haben, dass die Ermittlungen aus Guatemala gegen den ehemaligen politischen Chef der Polizei mit krassen Fehlern und Widersprüchen gespickt waren. Doch je länger die Untersuchungshaft andauerte, je grotesker die Widersprüche wurden, desto weniger konnte sich der Staatsanwalt eingestehen, einer politischen Intrige aufgesessen und den falschen eingekerkert zu haben. Weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte, wurden in Genf im Namen der Menschenrechte sämtliche Regeln eines fairen Prozesses über Bord geworfen. Der Zürcher Journalist Alex Baur begleitete den Fall Sperisen über mehrere Jahre. Seine "Protokolle eines Justizverbrechens", die hier in ungekürzter Länge widergegeben werden, wurden zwischen 2015 und 2020 in der Weltwoche veröffentlicht.
Inhaltsverzeichnis
2. Die Weltreise des Sperisen-Clans
4. «Wir sind den Opfern verpflichtet»
6. Aufstand der Rechtsprofessoren
7. Geheimdeal um lebenslänglich
10. «Ein Albtraum, der nie enden will»
12. Was die Genfer Justiz nicht hören will
13. Irgendwie, irgendwer, irgendwo
14. Und keiner ist verantwortlich
15. Guatemala unterstützt Sperisen
19. Jetzt muss Strassburg ran
23. Fall Sperisen wird immer surrealer
Die wichtigsten Stationen im Fall Sperisen
1. Die Genfer Konfusion
22. Oktober 2015 - Wegen eines Gefängnismassakers in Guatemala will die Genfer Justiz Erwin Sperisen lebenslang hinter Gitter schicken. Ist der Nachkomme von Schweizer Auswanderern wirklich ein Massenmörder – oder Opfer eines Justizverbrechens?
(Teil 1 einer Übersicht des Falles, von Alex Baur)
In den frühen Morgenstunden des 25. September 2006 stürmen in Guatemala-Stadt 2500 Einsatzkräfte – Polizisten, Soldaten, Sondereinheiten, Wärter – das Gefängnis El Pavón. Während sich die meisten der rund 1800 Insassen sofort ergeben, entspinnt sich im Ostteil des weitläufigen Geländes eine wilde Schiesserei. Nach 8 Uhr beruhigt sich die Lage, um 11 Uhr ziehen die Behörden vor versammelter Presse Bilanz: Das Gefängnis befindet sich unter Kontrolle, sieben Häftlinge sind tot, einer ist verletzt.
In den guatemaltekischen Medien wird die Razzia unter dem Oberbefehl des rechtskonservativen Innenministers Carlos Vielmann einhellig als Erfolg gefeiert. El Pavón, geplant und gebaut als Mustergefängnis mit Sportplätzen, Werkstätten und einem Gutsbetrieb, galt längst als Brutstätte des organisierten Verbrechens. Seit Jahren wagte sich kaum ein Gefängniswärter mehr auf das Gelände. El Pavón befand sich unter der Kontrolle von Gangsterbanden, die von hier aus ungestraft ihre Raubüberfälle, Drogengeschäfte, Mordanschläge und Entführungen organisierten. Den meisten Guatemalteken erschien der für lateinamerikanische Verhältnisse moderate Blutzoll als akzeptabel.
Sechs Jahre später, am 31. August 2012, überrascht ein siebenköpfiges, schwerbewaffnetes Einsatzkommando Erwin Sperisen in Genf auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums und führt ihn vor den Augen seiner verdatterten Frau in Handschellen ab. Seither sitzt der heute 44-jährige Erwin Sperisen im Genfer Untersuchungsgefängnis Champs-Dollon. Er wird beschuldigt, bei der Stürmung von El Pavón als Chef der guatemaltekischen Policía Nacional Civil (PNC) die Hinrichtung der sieben Gefangenen angeordnet und in einem Fall sogar eigenhändig ausgeführt zu haben.
Brisante Zeugenaussage
Sperisen ist Nachkomme von Schweizer Auswanderern, er ist in Guatemala geboren, hat sein Schweizer Bürgerrecht aber behalten und kann daher nicht ausgeliefert werden. Das war auch nicht nötig: Staatsanwalt Yves Bertossa (SP) brannte förmlich darauf, diesem Mann in Genf den Prozess zu machen. Seit Jahren zirkulierten in linken Kreisen Verdächtigungen gegen Sperisen, der laut ihnen in Guatemala als rechtsextremer Saubermann sein Unwesen getrieben haben soll, bevor er sich in die Heimat seiner Vorfahren absetzte. Endlich, so glaubte Bertossa, hatte er etwas Konkretes in der Hand.
Bereits am Tag nach der Verhaftung gab ein Franzose namens Philippe Biret bei Bertossa ein brisante Aussage zu Protokoll: Biret will mit eigenen Augen gesehen haben, wie Erwin Sperisen, umgeben von der Elite der guatemaltekischen Regierung, die Exekution der sieben Häftlinge überwachte. Dabei hätten sich diese längst ergeben und um Gnade gefleht. Einem der Opfer soll der hünenhafte Schweizer gemäss Biret eigenhändig in den Kopf geschossen haben. Ihn selber, so versicherte der Franzose, habe Sperisen am Leben gelassen, weil dieser diplomatische Komplikationen befürchtete.
Bertossa bekam Biret von der Organisation Trial vermittelt, einer linken Genfer NGO, die sich der Verfolgung ungesühnter politischer Verbrechen rund um den Erdball verschrieben hat. Biret war 1992 in Guatemala wegen eines Doppelmordes zu dreissig Jahren Gefängnis verurteilt worden und befand sich zur fraglichen Zeit in El Pavón. Obwohl eine vorzeitige Entlassung gemäss dem Gerichtsurteil explizit ausgeschlossen war, kam er im November 2007 frei. Das war aussergewöhnlich. Doch Bertossa stellte keine kritischen Fragen. Er brauchte den Franzosen als Schlüsselzeugen dringend. Bertossa hielt auch an Biret fest, als offenbar wurde, dass seine Horrorstory nicht stimmen konnte. Das Verfahren war an diesem Punkt nicht mehr zu stoppen. Der Staatsanwalt hatte sich mit der spektakulären Verhaftung von Sperisen selber unter Erfolgszwang gesetzt.
Auf den ersten Blick spricht einiges gegen Erwin Sperisen, der zwischen 2004 und 2007 als politischer Chef der PNC in Guatemala amtierte. Bereits im Dezember 2006 hatte der guatemaltekische Sonderstaatsanwalt für Menschenrechte Zweifel an der offiziellen Version geäussert, nach der die sieben Häftlinge im Gefecht gefallen seien. Bei den Ordnungskräften gab es keinen einzigen Verletzten, die Gefangenen dagegen waren alle sofort tot. Das ist umso erstaunlicher, als die Staatsanwaltschaft eine Stunde nach dem Feuergefecht schwere Waffen und Handgranaten neben den Leichen fand. Der Verdacht einer Inszenierung liegt nahe.
Bei der Schiesserei in El Pavón, die von zahlreichen Journalisten beobachtet wurde, gab es Hunderte von Augen- und Ohrenzeugen. Doch die Spurensicherung und die Obduktion der Leichen verliefen liederlich, die protokollierten Zeugenaussagen waren voller Widersprüche. Immerhin gab es Fotos der Leichen. Und diese zeigen Schusswunden, die schlecht zu einem Kampf passen. Druckstellen an Handgelenken deuten darauf hin, dass einzelne Häftlinge vor ihrem Tod gefesselt worden waren.
Eindeutig sind allerdings auch diese Indizien nicht. Niemand weiss, wann die mutmasslichen Druckstellen entstanden sind. Bei mehreren Opfern wurde «Tod infolge Blutverlusts» festgestellt, was eher gegen eine Exekution spricht. Bei den Akten liegt sodann ein Gerichtsgutachten aus Österreich; aus Videoaufnahmen schliesst der Experte, dass tatsächlich aus dem Gefängnis heraus geschossen wurde.
Schaute Sperisen einfach weg?
Einige der Toten, allen voran der kolumbianische Drogenbaron Jorge Batres und der Gangster Luis Zepeda, gehörten zur Führungsriege von El Pavón. Dass man sie gezielt eliminiert hatte, um langfristig die Kontrolle über den Knast zu gewinnen, würde Sinn machen. Es würde auch zum Bericht des Uno-Gesandten Philip Alston passen, der schon vor dem Fall El Pavón Hinweise auf «aussergerichtliche Exekutionen» fand. Auf die wirklich brisante Frage wusste aber auch Alston keine Antwort: Wer erteilte die Befehle?
Neben Polizei, Armee und Nachrichtendiensten mischten bei der Monsterrazzia in El Pavón auch vermummte Elitetruppen mit, die formell direkt dem Innenminister Carlos Vielmann unterstellt waren. Filmaufnahmen, die Polizeichef Sperisen hatte erstellen lassen – er selber war im fraglichen Zeitpunkt nachweislich nicht vor Ort –, weisen darauf hin, dass in erster Linie Vielmanns Elitetruppen in die Schiesserei verwickelt waren. Sie standen unter dem Kommando des gebürtigen Venezolaners Victor Rivera, einer schillernden Figur, der eine Vergangenheit bei der CIA nachgesagt wird. Doch Rivera kann leider nichts mehr sagen. Er wurde 2008 von Killern erschossen. Guatemala ist ein gefährliches und kompliziertes Land.
War es vielleicht der verzweifelte Versuch der Regierung, das Verbrechen mit Verbrechen zu besiegen? Oder ganz einfach eine Abrechnung unter Drogenkartellen, deren Tentakel bis tief in den Staatsapparat hineinreichen? Spielten die regulären Truppen und namentlich Polizeichef Sperisen mit, als die Todesschwadronen zuschlugen? Schauten sie einfach weg? Vielleicht hatte Riveras Sonderkommando die Schiesserei auch inszeniert, um im Pulvernebel des Gefechtes unbemerkt sein blutiges Handwerk zu verrichten. Alles ist möglich, nichts ist gewiss.
Jagd auf den ehemaligen Polizeichef
Justiz und Polizei haben in ganz Lateinamerika einen miserablen Ruf, und das gilt in ganz besonderem Mass für Guatemala. 36 Jahre Guerilla-Terror (1960–1996) haben das soziale und politische Gefüge des Landes nachhaltig beschädigt. Die mächtigen Drogenkartelle aus Mexiko und Kolumbien sorgen dafür, dass das Land nicht zur Ruhe kommt. Raub, Mord und Entführungen gehören zum Alltag der Guatemalteken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verbrechen je geklärt wird, ist minim. Und wenn einer im Gefängnis landet, heisst das noch lange nicht, dass er auch schuldig ist. Die Justiz war in diesem Land schon zu oft eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Korrupte Polizisten, die mehr oder weniger offenkundig mit Kriminellen kooperieren, statt sie zu bekämpfen, sind eher die Regel denn die Ausnahme. Wo die Justiz versagt, regiert das Faustrecht.
Welchen Part spielte Erwin Sperisen auf diesem Schlachtfeld? War er die Regel oder die Ausnahme? Hatte er als politischer Chef ohne polizeiliche Erfahrung seine Polizei überhaupt im Griff? War er Teil krimineller Seilschaften oder, wie er selber versichert, deren Opfer? Die guatemaltekische Justiz war nie in der Lage, eine überzeugende Antwort zu liefern. Doch Staatsanwalt Bertossa im fernen Genf glaubte den Fall von seinem Büro aus lösen zu können. Für ihn schien spätestens nach der Einvernahme des Schlüsselzeugen Biret alles klar zu sein.
Nicht, dass die guatemaltekische Justiz untätig geblieben wäre. Im Dezember 2006 rief die Regierung eine internationale Kommission ins Land, die Cicig, die unter dem Schutz der Uno Ordnung in die Strafverfolgung bringen sollte. Sonderermittlerin Gisela Rivera aus Costa Rica gelangte bald zum Schluss, dass hinter dem Massaker von El Pavón eine Verschwörung auf höchster Ebene steckte. 2009 verliess Rivera indes Guatemala fluchtartig. Gegen die Cicig-Ermittlerin liegt ein Haftbefehl vor wegen Begünstigung und Amtsgeheimnisverletzung. Die Cicig selber hatte die Anzeige erstattet. Gisela Rivera soll Zeugen zu Aussagen genötigt und illegale Absprachen getroffen haben.
Am politischen Umfeld konnte es nicht liegen, war die konservative Regierung in Guatemala doch längst von ihren sozialistischen Gegnern abgelöst worden. Gisela Rivera behauptet, ihr Vorgesetzter bei der Cicig, der Spanier Carlos Castresana, sei von der Oligarchie gekauft worden. Bevor auch Castresana seinen Sessel räumte, formulierte die Cicig im August 2010 immerhin eine Anklage gegen achtzehn Verdächtige im Fall El Pavón. Neben Innenminister Carlos Vielmann und Strafvollzugschef Alejandro Giammattei sind Erwin Sperisen und dessen Stellvertreter Javier Figueroa die vier prominentesten Verdächtigten. Verurteilt wurden am Ende aber nur drei subalterne Polizisten.
Grandios inszenierte Verfahren
Erwin Sperisen befand sich da längst in der Schweiz, was allerdings nichts mit dem Fall El Pavón zu tun hatte. Ende 2006 schickte er nach diversen Morddrohungen und einem vereitelten Entführungsversuch seine Frau und seine drei Kinder nach Genf zu seinem Vater, der hier als Uno-Diplomat arbeitet. Im März 2007 trat er von seinem Amt zurück und zog zu seiner Familie in die Schweiz. Auslöser dafür war der Fall von drei Politikern, die von Polizisten beim Kokainschmuggel überrascht, ausgeraubt und ermordet worden waren. Das bedeutete selbst für guatemaltekische Verhältnisse ein Skandal, der ein politisches Zeichen erforderte.
Wenige Monate nach Sperisens Ankunft in der Schweiz blies ein Netzwerk linker Hilfswerke (Uniterre, Acat, OMC) unter der Leitung der Organisation Trial zur Jagd auf den ehemaligen Polizeichef. Von El Pavón war allerdings noch keine Rede. Vielmehr ging es um einen blutigen Konflikt unter Bauern in einer abgelegenen Provinz, der neun Menschenleben gefordert hatte (wobei die Hilfswerke gerne unterschlagen, dass drei der Toten Polizisten waren; weitere 22 Polizisten erlitten gemäss einer parlamentarischen Untersuchung Schussverletzungen; der Polizeieinsatz war notabene vom obersten Gericht Guatemalas angeordnet worden). Sperisen war zur fraglichen Zeit einen Monat im Amt; ihn für das Blutvergiessen verantwortlich zu machen, ist absurd. Eines war damit allerdings von allem Anfang an klar: Die Affäre Sperisen ist politisch kontaminiert.
Nach der Cicig-Anklage in Guatemala meldet sich Erwin Sperisen im August 2010 spontan beim damaligen Genfer Generalstaatsanwalt Daniel Zappelli (FDP). Dieser kann mit dem Fall nicht viel anfangen. Das ändert sich schlagartig, als Zappelli ein Jahr später von den eigenen Leuten aus dem Amt gemobbt wird. Es ist just die Zeit, als Genosse Yves Bertossa zum Ersten Staatsanwalt emporsteigt. Bertossa, der ideologisch, freundschaftlich und familiär eng mit der Organisation Trial verbandelt ist, reisst das Dossier Sperisen nun an sich. Es sollte sein Gesellenstück werden.
Dazu muss man wissen: Yves Bertossa ist der Sohn des famosen Bernard Bertossa (SP), der als Generalstaatsanwalt (1990–2002) von Genf aus – gleichsam als Jean Ziegler der Justiz – einen internationalen Kreuzzug gegen Potentaten, Oligarchen und andere Raubtierkapitalisten führte. Zusammen mit seinem spanischen Pendant, Baltasar Garzón, liess er den chilenischen Ex-Diktator Augusto Pinochet 1998 international zur Verhaftung ausschreiben. Bernard Bertossa gehört zu den Gründern der Organisation Trial, die von der Stadt Genf mitfinanziert wird und auch schon die Verhaftung des ehemaligen US-Präsidenten George Bush forderte.
Bernard Bertossas medial grandios inszenierte Verfahren erwiesen sich mit fataler Regelmässigkeit als Flops. Der vermeintliche russische Mafiapate Sergej Michailow, dem der Staat Genf für zwei Jahre unschuldig erlittene Untersuchungshaft 800 000 Franken zahlen musste, ist ein Beispiel unter vielen. Nachfolger Zappelli versuchte, die Genfer Staatsanwälte wieder auf den Boden der helvetischen Realität zurückzubringen. Offenbar vergeblich.
«Einen Nachnamen hat er schon», spöttelten Genfer über den Sohn des famosen Generalstaatsanwaltes Bertossa, als dieser in die Fussstapfen seines Vaters trat, «jetzt braucht er nur noch einen Vornamen». Yves Bertossa liess nicht lange Taten sich warten. Mit der Verhaftung des Diktatoren-Filius Hannibal Gaddafi sorgte er 2008 für einen ersten Eklat. Auch der Fall Gaddafi war ein Rohrkrepierer mit beachtlichem Kollateralschaden. Sollte Erwin Sperisen den langersehnten Durchbruch bringen?
Im März 2014, zwei Monate vor dem Sperisen-Prozess, strahlt das Westschweizer Fernsehen RTS einen Dok-Film («Chasseurs de crimes») aus, der die Organisation Trial hochjubelt. Der Fall Sperisen steht im Zentrum des Streifens, wobei der blutige Konflikt mit den Bauern noch einmal aufgewärmt wird. Ausführlich kommt Philippe Biret zu Wort, Bertossas Schlüsselzeuge, der Sperisens angebliche Exekution in El Pavón dramatisch beschreibt. Immerhin erwähnen die Autoren, dass Birets Anschuldigungen bestritten werden. Doch das Schlusswort überlassen sie dem spanischen Bertossa-Kumpel Baltasar Garzón: Es sei halt schwierig, den wahren Kriminellen etwas nachzuweisen, trotzdem lohne sich der Kampf.
Die Öffentlichkeit scheint bestens eingestimmt – bis am 14. Mai 2014, einen Tag vor dem Sperisen-Prozess, die Zeitschrift L’Illustré eine Bombe platzen lässt: Die vermeintliche Privatklägerin, die Mutter eines der Opfer von El Pavón, weiss nichts vom Prozess in Genf; sie kennt die Anwälte nicht, die in ihrem Namen auftreten, sie weiss nichts von der Anklage gegen Sperisen, und sie hat auch nichts gegen den ehemaligen Polizeichef. Arnaud Bédat, ein erfahrener Reporter, hatte die Frau in Guatemala aufgesucht und das Gespräch mit ihr auf Video aufgezeichnet.
Der Scoop brachte die Organisation Trial, die mit der Frau spendenwirksam hausierte, arg in Verlegenheit. Aus juristischer Sicht änderte sich wenig: Mord ist ein Offizialdelikt und wird von Amtes wegen verfolgt. Es hätte gereicht, wenn Gerichtspräsidentin Isabelle Cuendet (SP) die Privatklägerin vorläufig suspendiert hätte, bis die Sache geklärt war. Doch die arrogante Reaktion von Cuendet liess tief blicken: Mit der gehässigen Bemerkung, sie lasse sich von Journalisten nicht ins Geschäft pfuschen, wischte sie die Affäre vom Tisch.
«Fall von Kolonialjustiz»
Die Stimmung im Gerichtssaal war von Anfang an vergiftet. «Wenn Erwin schuldig ist, soll er büssen», sagt sein Bruder Christian Sperisen, «doch jeder Angeschuldigte hat das Recht, ernst genommen und angehört zu werden.» Ihm sei schnell klargeworden, dass das Urteil schon vor dem Prozess festgestanden habe. Mal fiel Cuendet dem Angeklagten misslaunig ins Wort, wenn er nicht sagte, was sie von ihm hören wollte; mal bezichtigte sie ihn entnervt des «Katz-und-Maus-Spiels»; mal mokierte sie sich mit einer sarkastischen Geste über einen Entlastungszeugen.
Die aggressive Stimmung im Gerichtssaal habe ihn schockiert, sagt Reporter Bédat im Rückblick, etwas Vergleichbares habe er noch nie erlebt. Und er ist mit diesem Eindruck nicht allein. Die Gerichtsreporterin Catherine Focas kritisierte das ganze Verfahren später in der Tribune de Genève als einen «Fall von Kolonialjustiz». Hätte es sich bei Sperisen «um einen der lokalen Notabeln» gehandelt, schrieb sie, wäre man wohl nicht derart herablassend mit ihm umgesprungen.
Hält man sich an die im Hauptpunkt nur vier Seiten dünne Anklage von Staatsanwalt Bertossa, gab es einen auf höchster Ebene ausgearbeiteten Mordkomplott. Wer was wie wann genau entschieden und getan hat, liess er offen. Mit gutem Grund. Denn die Anklage stützt sich im Wesentlichen auf zwei Pfeiler, die sich gegenseitig widersprechen: Die Aussagen des Schlüsselzeugen Philippe Biret und die Untersuchungen der Cicig in Guatemala lassen sich schlecht auf einen Nenner bringen.
Birets Version lässt sich relativ einfach widerlegen: Gemäss sämtlichen Berichten erlitt keiner der sieben Häftlinge einen Kopfschuss, und auch zeitlich lag der Franzose, der das Massaker auf den späten Nachmittag verlegte, satte acht Stunden daneben. Warum Bertossa trotzdem an seiner Horrorstory festhielt, liegt auf der Hand: Auch die Angaben der Cicig-Zeugen sind löchrig und widersprüchlich. Und die wenigen Aussagen, die Sperisen belasten, kamen offenkundig durch Kronzeugenregelungen zustande: Mitverdächtige, die gegen ihren Vorgesetzten aussagten, wurden mit einem Straferlass und Zeugenschutzprogrammen belohnt. Solche Deals sind nach Schweizer Recht aber illegal, weil die Gefahr einer Falschanschuldigung zu gross ist.
Das Genfer Kriminalgericht pickte unter den widersprüchlichen Aussagen alles heraus, was Sperisen belastete, und verurteilte ihn am 6. Juni 2014 wegen siebenfachen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Was gegen seine Schuld sprach, wurde als unwesentlich abgetan, die krassen Unstimmigkeiten in Birets Version wurdeen mit einem angeblichen Trauma schöngeredet, das seine Erinnerung womöglich leicht verfälscht habe. Das 142 Seiten dicke juristische Machwerk wäre ein Thema für sich. Doch wir brauchen uns damit nicht mehr zu befassen, es ist inzwischen Makulatur.
Mit Urteil vom 12. Juli 2015 qualifizierte das Genfer Appellationsgericht die Schauergeschichte des Zeugen Biret als unglaubhaft. Auch die Cicig-Untersuchung gewichtete die Berufungsinstanz vorsichtshalber lediglich als Indiz. Trotzdem gelangten die Richter zu einem Schuldspruch: Erwin Sperisen war der Chef, er trage damit die Verantwortung für die Verbrechen, die unter seiner Herrschaft verübt wurden. Es sei nicht möglich, dass er die Exekutionen nicht bemerkt habe.
Während das Gericht die Kardinalfrage nach Sperisens Mitwissen mit wenigen Seiten abhandelte, dreht sich der grösste Teil der Urteilsbegründung um die Frage, ob tatsächlich eine Exekution vorlag. Nur hatte Sperisen selber diese Möglichkeit gar nie ausgeschlossen. Gemäss seiner Darstellung war sein martialischer Auftritt in Uniform am Rande der Stürmung von El Pavón reine Show. Der Einsatz sei von den jeweiligen Kommandanten geleitet worden, als politischer Chef der Polizei habe er eine rein repräsentative Funktion innegehabt.
Weil Sperisen den Mordplan nicht allein angeordnet haben kann, verurteilte das Genfer Appellationsgericht seinen Stellvertreter Javier Figueroa und den Strafvollzugschef Alejandro Giammattei gleich mit. Nur wurde derselbe Giammattei bereits 2011 in Guatemala in derselben Sache rechtskräftig freigesprochen. Figueroa, der heute als anerkannter Flüchtling in Österreich lebt, wurde 2013 nach einem aufwendigen Geschworenenprozess von jeder Schuld entlastet. Innenminister Carlos Vielmann geniesst derweil das Leben eines Pensionärs in Spanien. Erwin Sperisen kann heute nur noch auf das Bundesgericht in Lausanne hoffen, wo sein Fall hängig ist.
Jean Ziegler mischt sich ein
Warum fühlen sich die Genfer Richter so sicher in dieser verworrenen Geschichte, die sich weitab von ihrer Realität zutrug? Es lag wohl auch an einer Fotografie, die einen 193 Zentimeter grossen, bis an die Zähne bewaffneten Rotschopf bei der Razzia in El Pavón zeigt. Das Bild, das die Berichterstattung über Erwin Sperisen dominierte, wirkt wie eine Karikatur des brutalen Gringo-Söldners, der im Reich der Maya-Bauern über Leichen stampft.
Der Genfer Agitprofessor Jean Ziegler, der eine ganze Reihe von Kommentaren über den Fall verfasste, brachte das Gefühl auf den Punkt: Er beschreibt Sperisen als Sprössling skrupelloser Grossgrundbesitzer, der als «allmächtiger Polizeichef» im Dienste der Oligarchie arme Indiobauern mit «sozialen Säuberungen» knechtete und «dank der energischen, klugen Arbeit von Nichtregierungsorganisationen» endlich zur Strecke gebracht worden sei. Das Bild ist wohlfeil, man kennt es aus Hollywoodfilmen – nur hat es wenig zu tun mit der Realität, die sich dahinter verbirgt.
(Copyright: Weltwoche, Ausgaben-Nr. 43/2015, Seite 44)
2. Die Weltreise des Sperisen-Clans
29. Oktober 2015 - Um seine Familie vor Gangstern zu schützen, kehrte der ehemalige guatemaltekische Polizeichef Erwin Sperisen in die Heimat seiner Vorfahren zurück. Doch in der Schweiz landete er aufgrund einer politischen Kampagne in der Folge selber im Gefängnis, seine Familie geriet in Sippenhaft.
(Teil 2 einer Übersicht zum Fall von Alex Baur)
Seit drei Jahren und zwei Monaten ist die Welt des Erwin Sperisen rechteckig, sie besteht aus einer Pritsche, einem Stuhl, einem Tisch und ist exakt 10,18 Quadratmeter gross. Das ist die Fläche einer Zelle im Genfer Untersuchungsgefängnis Champ-Dollon. Einmal täglich darf der fast zwei Meter grosse Hüne die Zelle für eine Stunde verlassen, um sich die Beine in einem etwas grösseren Gitterkäfig zu vertreten. Kontakte zu Mitgefangenen hat er keine. Denn Sperisen soll, so man der Genfer Justiz trauen will, ein gefährlicher Mann sein.
Während zweier Stunden pro Woche darf Erwin Sperisen unter strenger Bewachung seine Frau Elisabeth und seine Kinder sehen. Die einst erfolgreiche Ökonomin lebt mittlerweile von der Sozialhilfe und teilt sich mit den drei Kindern eine Zweizimmerwohnung. Doch selbst das schien den Genfer Behörden noch zu viel. Sie wollten Elisabeth Sperisen letztes Jahr des Landes verweisen. Anders als ihr Mann und die Kinder hat sie keinen Schweizer Pass.
Es ist das bittere Ende einer Saga von Auswanderern aus dem solothurnischen Niederwil. Sie begann vor neunzig Jahren. Nach Abschluss der Rekrutenschule suchte Franz Sperisen 1925 sein Glück zuerst als Bürokraft in Belgien. Drei Jahre später überquerte er an der Seite eines Freundes, der kurz nach der Ankunft in Guatemala an Typhus verstarb, mit der «SS Orion» den Atlantik. Franz Sperisen fand Arbeit als Verwalter auf diversen Kaffeeplantagen. Zwölf Jahre später, nachdem er genügend Geld gespart hatte, liess er Babette Jurt aus Luzern nachreisen, seine künftige Frau.
Die Geschichte der Sperisens steht für Zehntausende von Schweizern, die Anfang des letzten Jahrhunderts in der Neuen Welt ein besseres Leben suchten. Als Uhrmacher, Bäcker, Hoteliers, Unternehmer oder Farmer geniessen die suizos in ganz Lateinamerika bis heute einen vorzüglichen Ruf. Einige brachten es sogar zu Ruhm. Jacobo Arbenz etwa, Sohn des Apothekers Jakob Arbenz aus Andelfingen, ein Freund von Franz Sperisen, wurde 1950 in Guatemala zum Staatspräsidenten gewählt. Doch die allermeisten der zurzeit 1189 in Guatemala gemeldeten Schweizer gehören der Mittelschicht an. So auch die Sperisens.
Franz und Babette Sperisen gründeten eine Glaserei in Guatemala-Stadt. 1958, nachdem Franz an Krebs erkrankt war, kehrte das Ehepaar mit den drei Kindern in die Schweiz zurück. Der Betrieb ging verloren. Edi war damals zehn Jahre alt. Während seine älteren Geschwister in der Schweiz blieben, kehrte er, sobald er die Rekrutenschule hinter sich hatte, nach Guatemala zurück. Dort lernte er seine Frau Linda kennen, eine feurige Guatemaltekin mit amerikanischen Wurzeln, die ihm vier Söhne schenkte. Der 1970 geborene Erwin, der heute in Champ-Dollon festsitzt, ist der älteste.
Auch Edi und Linda Sperisen fingen ganz unten an, zuerst mit einer Glaserei, dann mit einer Schreinerei, die über die Jahre zu einer kleinen Fabrik heranwuchs. In ihren besten Zeiten produzierten 350 Arbeiter Gartenmöbel für den Export in die USA. Um bürokratische Leerläufe zu bekämpfen, gründete Sperisen mit anderen Exporteuren einen Interessensverband, den er mit Erfolg präsidierte. So rutschte er in die Politik.
Alvaro Arzú holte Edi Sperisen 1996 als Vizeminister in seine Mitte-rechts-Regierung. Arzú, der auch mehrmals zum Bürgermeister von Guatemala-Stadt gewählt wurde, geniesst wegen seines Einsatzes für die Demokratie und den Friedenspakt mit den Guerillas Respekt über alle Parteien hinweg. Arzú war es auch, der Edi Sperisen später als Botschafter zur Welthandelsorganisation WTO nach Genf schickte, wo er bis heute in leitender Funktion wirkt.
1996 war ein Jahr der Hoffnung, aber auch der Ernüchterung in Guatemala. Der Friedenspakt mit den Guerillas war kaum unterzeichnet, als diese einen Sprössling aus dem Sperisen-Clan entführten. Der junge Mann hatte als Agronom auf einer Finca gearbeitet. Der damals 26-jährige Erwin Sperisen brachte den Gangstern das Lösegeld in den Dschungel. Dass just Erwin diese gefährliche Mission übernahm, sagt seine Mutter Linda, sei typisch für ihn gewesen. Ihr Erstgeborener sei schon als Kind ein unerschrockener Idealist gewesen, der seine drei kleineren Brüder anstelle des beruflich oft abwesenden Vaters herumkommandiert, aber eben auch beschützt habe.
Sperisens Begeisterung für die Freiwilligenfeuerwehr, der er im Alter von sechzehn Jahren beitrat, passt in dieses Bild. Ausser vielleicht seiner Leidenschaft für schwere Motorräder, die er von seiner Mutter Linda geerbt hat, findet sich wenig Extravagantes in seiner Biografie. Während seine Altersgenossen Fussball spielten oder den Mädchen nachstiegen, engagierte sich der grossgewachsene Rotschopf Erwin bereits als Teenager für die rechtsliberale PAN-Bewegung der späteren Präsidenten Alvaro Arzú und Oscar Berger. Auch sein Vater sympathisierte mit deren Politik.
Folgerichtig studiert Erwin Sperisen Politologie an der Universidad Francisco Marroquín. Dort lernt er Elisabeth kennen, eine Salvadorianerin mit Schweizer Vorfahren. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, sagt sie. Neben den helvetischen Wurzeln und dem Interesse für Politik, ökonomische und soziale Fragen gab es eine praktische Gemeinsamkeit: Erwin (194 cm) und Elisabeth (184 cm) sind für guatemaltekische Verhältnisse von riesenhafter Statur.
Aussenseiter mit eiserner Moral
Beide finanzierten ihr Studium selber. Während Elisabeth für einen liberalen Think-Tank arbeitete, holte der damalige Bürgermeister von Guatemala-Stadt und spätere Präsident Oscar Berger den ehrgeizigen, jungen Sperisen in seine Verwaltung. 1997 heirateten die beiden, drei Jahre später kam das erste ihrer drei gemeinsamen Kinder zur Welt. Elisabeth Sperisen arbeitete trotzdem weiter. Hier liegt auch die Erklärung dafür, dass sich das junge Paar ein bescheidenes Häuschen in einem mittelständischen Viertel und die relativ teure deutsche Schule für die Kinder leisten konnte.
Im Juli 2004 erhielt Erwin Sperisen einen überraschenden Anruf aus dem Regierungspalast, der das Leben der ganzen Familie auf den Kopf stellen sollte: Innenminister Carlos Vielmann, der mit Oscar Berger wenige Monate zuvor an die Macht gekommen war, wollte Sperisen als politischen Chef der Policía Nacional Civil (PNC) an Bord holen. Ein verrücktes Unterfangen. Wie sollte der Akademiker Sperisen, der keine Ahnung von der Polizeiarbeit hatte und dessen Kommandoerfahrung sich auf die freiwillige Feuerwehr beschränkte, ein Korps mit 22 000 Polizisten in den Griff kriegen?
Der guatemaltekischen Polizei hängt ein miserabler Ruf an, sie gilt als korrupt und macht nicht selten mit Gangsterbanden gemeinsame Sache. Doch genau wegen seines eklatanten Mangels an Beziehungen setzten Vielmann und Berger auf Sperisen: Nur ein Aussenseiter mit eiserner Moral und viel Idealismus konnte Ordnung in diesen unübersichtlichen Haufen bringen, in dem keiner dem andern traute. Sofern das überhaupt möglich war.
Seine Brüder, seine Eltern, seine Freunde versuchten, Erwin Sperisen diese unmögliche Mission auszureden. Dazu muss man wissen: Die Halbwertszeit eines Polizeichefs in Guatemala beträgt einige Wochen bis höchstens ein paar Monate – dann muss er im besten Fall wegen irgendeines Skandals zurücktreten, im schlimmeren Fall wird er einfach erschossen. Bürgermeister Fritz García Gallont, sein bis anhin grösster Förderer, lud Erwin Sperisen extra zum Frühstück ein, um ihm dieses Himmelfahrtskommando auszureden. Doch die Einwände schienen ihn erst recht anzuspornen. «Wenn Erwin von einer Sache überzeugt ist», sagt seine Frau Elisabeth, «hilft kein Flehen und kein Drohen, dann macht er es.»
Anfang August 2004 trat Erwin Sperisen seine Stelle an. Der erste Skandal liess keine vier Wochen auf sich warten. Auf Befehl des Obersten Gerichtshofes musste die Policía Nacional Ende August die Finca Nueva Linda räumen, eine Farm bei Retalhuleu an der Pazifikküste, die im Zuge eines komplizierten Konfliktes unter zwei Bauernorganisationen von über tausend zum Teil bewaffneten Aufständischen besetzt worden war. Beim Zusammenstoss kamen sechs Bauern und drei Polizisten ums Leben. 22 Polizisten wurden durch Kugeln verwundet, und wären sie nicht mit kugelsicheren Westen ausgerüstet gewesen, wären mit Sicherheit mehr Polizisten gestorben.
Hätte Sperisen den gerichtlichen Räumungsbefehl ignorieren sollen? Hätten seine Truppen die bewaffnete Auseinandersetzung verweigern sollen? In Guatemala, wo man den Terror bewaffneter Banden mehr als satthatte, waren das rhetorische Fragen. Obwohl Polizeichef Sperisen mit dem blutigen Einsatz direkt wenig zu tun hatte, handelte er sich damit den ewigen Hass der international hervorragend vernetzten Drittweltisten-Szene ein. Linke Hilfswerke stilisierten die Affäre «Finca Nueva Linda» zum Fanal hoch; sie sollte später als Ausgangspunkt der Hatz gegen Sperisen in der Schweiz dienen.
Entführung eines Sohnes vereitelt
Damals hatte Erwin Sperisen freilich ganz andere Sorgen. Im Kampf gegen die Korruption setzte er zum einen auf bessere Arbeitsbedingungen, durch welche die Polizisten enger an ihr Korps gebunden werden sollten. Ein Thema war neben den Renten für die Witwen und Waisen ermordeter Polizisten eine Reform der Gesundheitsversorgung bei der Polizei. Das war der Grund, warum Sperisen seinen Jugendfreund Javier Figueroa, den er von der Feuerwehr her kannte, zu seinem Stellvertreter ernannte. Figueroa war Arzt. Fachwissen kam ihm auch beim zweiten Schwerpunkt der Reformen zupass: Sperisen wollte der Polizei endlich zu einem modernen rechtsmedizinischen und kriminalistischen Dienst verhelfen.
Fast drei Jahre lang – für guatemaltekische Verhältnisse eine Rekordzeit – konnte sich Sperisen als Polizeichef halten. Für seine Frau und seine Kinder, die sich nur noch unter dem Schutz schwerbewaffneter Bodyguards bewegen konnten, war es eine schwierige Zeit. Nachdem Ende 2006 die Entführung eines Sohnes vereitelt werden konnte, zog Elisabeth Sperisen mit den drei Kindern zu den Schwiegereltern nach Genf. Im Frühling 2007 reiste Erwin Sperisen nach. Nach einem Skandal um vier Polizisten, die drei Parlamentarier im Umfeld eines Kokaindeals ermordet hatten und später im Gefängnis selber umgebracht wurden, hatte er sein Amt niedergelegt.
An sich wollte das Ehepaar Sperisen nur etwa ein halbes Jahr in Genf bleiben, so lang, bis sich der Pulverdampf in Guatemala verzogen hätte. Doch Elisabeth hatte in der Zwischenzeit eine sehr gute Stelle bei der Uno gefunden, die Kinder lebten sich in Genf schnell ein, auch die Grosseltern waren glücklich über den Familiennachzug. Erwin Sperisen hatte Aussicht auf einen Job bei Interpol in Lyon, wo man sein Engagement in Guatemala wohlwollend zur Kenntnis genommen hatte. Alles schien auf bestem Weg. Doch hinter den Kulissen war die Diffamierungskampagne linker Grüppchen aus der Drittweltisten-Szene (Uniterre, Acat, OMCT, Trial) gegen Sperisen längst im Gange. (Weltwoche Nr. 43/15 – «Die Genfer Konfusion»).
Eine Rolle spielte wohl auch der politische Kurswechsel, der 2008 in Guatemala stattgefunden hatte: Mit Álvaro Colom kam nach zwei gemässigt liberalen Jahrzehnten eine sozialdemokratische Regierung an die Macht. Dass die neuen Machthaber ihre Vorgänger mit Strafklagen eindecken, die irgendwann versanden, gehört in Guatemala zur politischen Folklore. Inzwischen hatte auch die Cicig ihre Arbeit aufgenommen, eine noch von Berger einberufene und von der Schweiz mitfinanzierte Organisation, welche die guatemaltekische Strafjustiz unterstützen sollte. Die Cicig knöpfte sich sogleich den Fall von sieben Häftlingen vor, die im September 2006 bei einer Grossrazzia im Gefängnis Pavón von Sicherheitskräften erschossen worden waren.
Im August 2008 formuliert die Cicig mit guatemaltekischen Staatsanwälten eine Anklage gegen achtzehn zum Teil hochrangige Amtsträger der Regierung Berger, die beim Sturm auf Pavón in irgendeiner Form beteiligt waren. Neben Innenminister Vielmann und Vollzugschef Alejandro Giammattei finden sich auch Sperisen und sein Stellvertreter Javier Figueroa auf der Liste. Die direkt involvierten Staatsanwälte wurden bezeichnenderweise verschont.
Auf die Anschuldigungen werden wir in der nächsten Folge zurückkommen. So viel vorweg: Die Untersuchung in Guatemala ist gespickt mit Widersprüchen, Unschärfen und Lücken. Und sie baut auf Kronzeugendeals, die in der Schweiz illegal sind. Das ganze Dossier trägt eher politische denn juristische Züge. Nicht zuletzt geht es auch um Reparationszahlungen in für guatemaltekische Verhältnisse astronomischen Grössenordnungen.
Erwin Sperisen hatte aufgrund der Anschuldigungen fortan keine Aussicht mehr auf einen Job. Von der Interpol hörte er nichts mehr. Er betätigte sich als Hausmann. Kurz nach der Anklageerhebung gegen ihn verlor Elisabeth ihre Stelle bei der Uno. Eine offizielle Begründung gibt es nicht. Es ist eine der bittersten Passagen dieser Tragödie: Die Sperisens gerieten in Sippenhaft. Das bekam auch Vater Edi Sperisen zu spüren: Wegen seiner Doppelbürgerschaft drohte ihm Bern plötzlich mit dem Entzug des diplomatischen Status. Er gab in der Folge seinen Schweizer Pass ab.
Der Rest ist bekannt. Obwohl er sich aus eigenen Stücken bei der Genfer Staatsanwaltschaft gemeldet und seine Kooperation angeboten hatte, wurde Erwin Sperisen im August 2012 auf offener Strasse verhaftet. Der eng mit der NGO Trial verbandelte Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa rechtfertigte die spektakuläre Verhaftungsaktion mit Fluchtgefahr.
Wohin Sperisen fliehen sollte, blieb allerdings rätselhaft. Nach Guatemala, wo sein angeblicher Komplize Alejandro Giammattei soeben freigesprochen worden war? Nach Österreich, wo Javier Figueroa, der andere angebliche Mitverschwörer, 2013 in einem aufwendigen Geschworenenprozess in exakt derselben Sache ebenfalls freigesprochen wurde?
«Das österreichische Geschworenengericht hatte eben keine Kenntnis vom Dossier», erklärte Ankläger Bertossa im letzten Mai vor dem Genfer Appellationsgericht. Tatsächlich urteilten die Geschworenen in Österreich allein aufgrund der unmittelbaren Zeugnisse von Menschen aus Fleisch und Blut. Die Aktenrichter in Genf dagegen stützten sich in wesentlichen Punkten auf die politisch verseuchten Untersuchungen im fernen Guatemala, von denen niemand genau weiss, mit welchen Mitteln sie zustande kamen. Die Geschichte, der Charakter und die Beweggründe des Erwin Sperisen werden im Genfer Urteil denn auch mit ein paar leeren Worthülsen abgetan. Für die Genfer Justiz ist er nicht mehr als eine abstrakte Figur, an der ein Exempel statuiert wird. Das Urteilen – lebenslänglich wegen mehrfachen Mordes – fällt unter diesen Umständen viel leichter.
Jean Zieglers Fantasie
«Gerechtigkeit und Vernunft sind zum Durchbruch gekommen», jubelte der Genfer Professor Jean Ziegler nach dem Schuldspruch. Dank der «energischen und klugen Arbeit von Nichtregierungsorganisationen» habe man einen Sprössling und Lakaien der «unerhört reichen Oligarchen» zur Strecke gebracht. Mit «unerbittlicher Gewalt», so Ziegler, sei der «allmächtige Polizeichef» gegen «aufständische, bitterarme Tagelöhner, hungernde Arbeiter und protestierende Gewerkschafter» vorgegangen. Treffender kann man die Geisteswelt, in der der Schuldspruch zustande gekommen war, nicht umschreiben. Der Professor fabuliert sogar von «sieben jungen Menschen», die Sperisen persönlich exekutiert habe, weil diese «gegen die Misshandlung durch die Wärter» protestiert hätten. Zieglers Fantasie liegt 6000 Meilen von der guatemaltekischen Realität entfernt.
(Copyright: Die Weltwoche Ausgabe-Nr. 44/2015, Seite 44)
3. Ein höllisches Experiment
05. November 2015 - Die Genfer Justiz will Erwin Sperisen lebenslänglich einsperren, weil er bei Exekutionen in Guatemala mitgewirkt haben soll. Doch das Dossier ist gespickt mit Ungereimtheiten. Klar ist: Der politische Druck, Sperisen trotz zahlloser Widersprüche zu verurteilen, war übermächtig.
(Teil 3 einer Übersicht des Falles von Alex Baur)
Der Anruf aus dem Innenministerium kam für Alejandro Giammattei völlig unerwartet. Es war Ende Oktober 2005. Giammattei ahnte, dass es etwas mit der Flucht von neunzehn Verbrechern aus dem Hochsicherheitsgefängnis El Infiernito zu tun haben könnte. Durch den Skandal geriet Innenminister Carlos Vielmann in Zugzwang. Dass ihn Vielmann gleich zum höchsten Gefängnischef von Guatemala machen wollte, überraschte den Arzt Giammattei allerdings. Er habe doch keine Ahnung vom Strafvollzug, wandte er ein. Genau das sei nun gefragt, erwiderte der Minister, einer, der von aussen komme, um das durch und durch korrupte System aufzumischen.
Giammattei verlangte eine Woche Bedenkzeit. Alle Freunde und Angehörigen rieten ihm dringend ab. Der Strafvollzug in Guatemala befand sich in einem erbärmlichen Zustand. Dieses System in Ordnung zu bringen, so warnte man ihn, sei eine übermenschliche Aufgabe, an der sich ein anständiger Mensch nur die Finger verbrennen könne. Bevor er einen Entscheid fällte, wollte Giammattei die vier wichtigsten Gefängnisse von innen sehen. Vielmann erfüllte ihm den Wunsch.
Wie Sklaven
Was Giammattei in der Folge bei seiner ausgedehnten Erkundungstour durch die guatemaltekischen Gefängnisse erfuhr und erlebte, übertraf die schlimmsten Befürchtungen und ist in einem Buch* nachzulesen, das er später verfasste. Crack-Leichen, Prostitution, Waffen, Gewalt und sexuelle Übergriffe bestimmten den Alltag in den Gefängnissen. Das Vollzugspersonal hatte längst resigniert und versuchte gar nicht erst, etwas dagegen zu unternehmen.
In der Granja Modelo de Rehabilitación Penal el Pavón waren die Missstände besonders krass. Der Arzt entdeckte ein System, das an die Sklaverei gemahnt. Das Gefängnis befand sich unter der Kontrolle von Gangsterbanden. Wer in einem Bett schlafen wollte, musste bezahlen – und wer nicht zahlen konnte, den Gangstern zudienen. Neue Häftlinge wurden an Auktionen an die Knastbosse versteigert. Wer nicht gehorchte, musste mit brutalen Strafen oder gar mit dem Tod rechnen.
El Pavón war in den 1970er Jahren als Vorzeigemodell mit eigenem Gutsbetrieb und Werkstätten gebaut worden. Über das Komitee für Ordnung und Disziplin (COD) hatten die Insassen eine gewisse Autonomie. Doch das COD hatte längst die Kontrolle über den Knast übernommen und die Wärter aus dem Areal verbannt. Der Zugang zum Gelände war nicht etwa von aussen, sondern von innen verriegelt. Das Gefängnispersonal arbeitete faktisch im Sold von Drogenbaronen, die ihnen ungleich höhere «Saläre» bezahlten als der Staat.
Aus dem Mitsprachemodell war ein höllisches Experiment geworden, das seinesgleichen sucht. Giammattei stellte zwar fest, dass das streng hierarchische Knastregime erstaunlich geordnet funktionierte. Es gab sogar eine Art Grundbuchamt. Wer es sich leisten konnte, der lebte im eigenen Chalet mit allem, was dazugehört: Jacuzzi, abhörsichere Telefone, Dienstpersonal und Bodyguards. Effizient organisiert waren aber auch die Fälscherwerkstätten, Drogenlabors und Garagen, in denen gestohlene Autos umgebaut wurden. Entführer-, Drogen- und Räuberbanden operierten ungeniert und ungestraft von El Pavón aus. Es gab Fälle von Entführten, die hier versteckt wurden. Die Polizei fand Hinweise darauf, dass in El Pavón sogar sadistische Gewalt- und Kinderpornos hergestellt wurden. 2003 starben zwei Polizisten beim Versuch, Delinquenten ins Gefängnis hinein zu verfolgen.
«Wer als Krimineller hier reinkommt», konstatierte Giammattei, «kommt als Soziopath wieder raus.» Am Ende war es aber eine zufällige Beobachtung, die den Arzt zur Zusage bewegte: Er stellte fest, dass an Besucherinnen Intimkontrollen ohne hygienischen Schutz vorgenommen wurden. Wer sich bei der Leibesvisitation keine Geschlechtskrankheit zuzog, konnte von Glück reden. Der Arzt war erschüttert – und sagte zu. Bereits am Tag der Amtsübergabe erlebte er seine Feuertaufe: eine Meuterei im Frauengefängnis Santa Teresa. Die Insassinnen verlangten eine Lockerung des Regimes bei Männerbesuchen. Dank einem persönlichen Einsatz vor Ort konnte Giammattei den Aufstand friedlich beilegen.
Der Fatalismus im Verwaltungsapparat war betäubend. In einem ersten Schritt versuchte Giammattei die Führungscrew zu ersetzen. Ein hoffnungsloses Unterfangen. 58 Freunden und Vertrauten bot er Schlüsselstellen an, alle wünschten ihm viel Erfolg, kein einziger sagte zu. Giammattei ermunterte den Sonderstaatsanwalt für Menschenrechte, Sergio Morales, in El Pavón eine Filiale zu eröffnen. Morales wies das Angebot schroff zurück. Das Interesse des mediengewandten Menschenrechtsanwaltes für die namenlosen Opfer der alltäglichen Gewalt hielt sich offenbar in Grenzen. Er sollte später zu seinem ärgsten Widersacher werden.
Ein wichtiges Anliegen war die elektronische Erfassung der Insassen. Niemand wusste, wie viele es genau waren. Offenbar gab es Häftlinge, die ihre Strafe längst verbüsst hatten und deren Karteikarte im Apparat verlorengegangen war. Mittelfristig setzte sich Giammattei das Ziel, die Gefängnisse wieder unter die Kontrolle des Staates zu bringen.
Der Anfang sollte in El Pavón mit seinen 1800 Insassen gemacht werden. Und weil dies eine militärische Operation war, beauftragte Giammattei einen Mann vom militärischen Nachrichtendienst mit der Planung: Luis Linares Pérez. Der Geheimdienstler erhielt zudem den Auftrag, El Pavón mit Informanten zu infiltrieren und eine Liste der wichtigsten Anführer zu erstellen, die man auf andere Gefängnisse verteilen wollte. Später wird man behaupten, es sei in Wirklichkeit eine Todesliste gewesen.
Am 18. Juli 2006 spitzt sich die Lage in El Pavón zu. Luis Zepeda, der ungekrönte Knastkönig, stellt ein Ultimatum: 57 Häftlinge, die offenbar zu wenig Gewinn abwerfen, sollten das Gefängnis sofort verlassen, ansonsten er für nichts garantieren könne. Im Klartext: Die Männer würden umgebracht. Giammattei lässt sich nicht auf die Erpressung ein. Am 11. September wird der erste der verstossenen Häftlinge, José Hernández, ermordet. Die Zeit drängt.
Sturm auf El Pavón
Am 25. September 2006 ist es so weit: In den frühen Morgenstunden kreist ein Aufgebot von 2500 Einsatzkräften – Armee, Polizei, Sonderkommandos, Vollzugspersonal – nach dem Plan von Linares Pérez das weitläufige Gelände von El Pavón ein. Um 5 Uhr werden die Insassen per Lautsprecher aufgerufen, die Gebäude zu verlassen und sich auf den Sportplätzen zu versammeln. Alejandro Giammattei verfolgt den Einsatz an der Seite von Polizeichef Erwin Sperisen im Kommandoraum, der sich beim Haupteingang befindet, auf der Nordseite. Um sechs Uhr wird die Stromzufuhr gekappt. Eine halbe Stunde später beginnt der Sturm auf El Pavón.
Auf der Südseite des weitläufigen Geländes sprengen Einsatztruppen zwei Breschen in die Zäune und stürmen das Gefängnis von zwei Flanken her. Beim Chalet des kolumbianischen Drogenbarons Jorge Batres kommt es gegen 7 Uhr zu einer wilden Schiesserei, die rund 20 Minuten dauert. Sperisen befindet sich in diesem Zeitraum mit seinem Tross auf der gegenüberliegenden Nordseite beim Haupteingang. Erst um 7 Uhr 40 begibt er sich zur Südostseite, wie Videoaufnahmen belegen. Spätestens hier erfährt er, dass im Chalet von Batres sieben erschossene Häftlinge liegen. Der Drogenbaron selber sowie Knastkönig Luis Zepeda befinden sich unter den Toten.
Gegen 8 Uhr betritt Innenminister Vielmann das Gelände, in seinem Tross befinden sich mehrere Journalisten und Staatsanwälte. Gegen 10 Uhr beginnen mehrere Equipen der Staatsanwaltschaft mit der Spurensicherung und der Bergung der Toten im Chalet von Batres. Gegen 11 Uhr informieren die involvierten Behörden an einer Pressekonferenz über die «Aktion Pavo Real». Die guatemaltekischen Medien feiern die Razzia unisono als Erfolg, obwohl schnell der Verdacht aufkommt, dass zumindest einzelne der sieben Toten exekutiert worden sein könnten.
Einige Indizien sprechen dafür. Kein einziger Polizist wurde bei der Schiesserei verletzt, die sieben Häftlinge dagegen waren sofort tot. Soweit man der rudimentären und schlampigen Spurensicherung der Staatsanwaltschaft trauen darf, passen viele der Schussverletzungen an den Leichen schlecht zu einem Feuergefecht. Bei zwei Leichen finden sich Hinweise auf Druckspuren an den Handgelenken, die auf eine Fesselung zurückzuführen sein könnten. Die Namen von mehreren Toten sollen sich auch auf der Liste der einflussreichsten Häftlinge befinden, die der Geheimdienstler Linares Pérez erstellt haben will. Beweisen lässt sich das freilich nicht, die ominöse Liste wurde nie sichergestellt.
Bei der Schiesserei war Polizeichef Sperisen nicht vor Ort, wie Videoaufnahmen belegen, wohl aber sein Stellvertreter Javier Figueroa. Die Bilder zeigen zudem, dass vermummte Sonderkommandos ohne Rangabzeichen den Sturm auf Batres’ Chalet ausführten. Es dürfte sich dabei um die sogenannten Riveritas gehandelt haben, eine nach ihrem Chef Victor Rivera benannte Sondereinheit, welcher direkt dem Innenministerium unterstellt war. Leider kann Rivera nichts mehr dazu sagen, er wurde 2008 ermordet. Die Aussagen anderer Mitglieder des Kommandos wurden trotz Anfragen nie nach Genf übermittelt.
Theoretisch war die Aktion Pavo Real hochgeheim, tatsächlich wurde sie am Vortag von einer Zeitung bis ins Detail angekündigt. Die Häftlinge wussten also, was sie erwartete. Der Sturm auf El Pavón wurde von zahlreichen Journalisten verfolgt. Unter den Augen Hunderter Zeugen unbemerkt sieben Menschen zu exekutieren, war doch ziemlich schwierig. Doch es ist denkbar, dass die Riveritas das Chaos der Schiesserei um das Chalet von Batres für gezielte Exekutionen nutzten. Geht man von dieser These aus, stellt sich eine ungleich schwierigere Frage: Wer gab den Auftrag? Von rivalisierenden Gangstern über die Geheimdienste und das Militär bis zur Regierung kommen alle in Frage – und nichts ist beweisbar.
Als die internationale Cicig-Kommission und der bereits erwähnte Menschenrechtsanwalt Sergio Morales nach dem Regierungswechsel von 2008 die Ermittlungen aufnahmen, konzentrierten sie sich auf die politisch Verantwortlichen: Innenminister Vielmann, Vollzugschef Giammattei, Polizeichef Sperisen und dessen Stellvertreter Figueroa. Die involvierten Staatsanwälte, Sonderkommandos und Militärs wurden dagegen verschont. In einem Kraftakt wollten die internationale Organisation Cicig und Morales offenkundig ein politisches Zeichen setzen. Doch Justiz und Politik vertragen sich schlecht.
Reine Staffage
Eine politische Verantwortung begründet noch lange keine strafrechtliche Schuld. Das Buch von Giammattei illustriert die Ohnmacht der politischen Amtsträger eindrücklich. Der Arzt wurde 2012 in Guatemala nach einem Jahr Untersuchungshaft denn auch von Schuld und Strafe freigesprochen, ebenso mehrere Polizisten. 2013 folgte der Freispruch von Figueroa, übrigens auch er ein Arzt, in Österreich. Das Verfahren gegen Innenminister Vielmann liegt in Spanien auf Eis. Getroffen hat es am Ende einzig Polizeichef Sperisen. Das Genfer Appellationsgericht verurteilte ihn im letzten Mai wegen mehrfachen Mordes zu lebenslänglich (Weltwoche Nr. 43/15 – «Die Genfer Konfusion»).
Erwin Sperisen schloss nie aus, dass es beim Sturm auf El Pavón Exekutionen gegeben haben könnte. Er bestreitet nur, dass er damit etwas zu tun hatte. Der Polizeieinsatz wurde vom zuständigen Kommandanten geplant und geleitet, als politischer Chef der Polizei hatte Sperisen keinen direkten Einfluss auf die Operation. Sein martialischer Auftritt – Sperisen liess sich vor Ort in Uniform und mit schwerer Bewaffnung ablichten – sei reine Staffage gewesen. Er habe damit ein politisches Zeichen setzen wollen: eine symbolische Kriegserklärung an das organisierte Verbrechen. In die Untersuchung der Todesfälle habe er sich nie eingemischt, weil ihm dies schlicht untersagt war. Das war die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, die von Anfang an vor Ort war.
Doch die Anklage lautet nicht auf Prahlerei, sondern auf mehrfachen Mord. Im fernen Genf stiessen Sperisens Erklärungen auf taube Ohren. «Auf dem Schlachtfeld befehlen die Chefs», rief Staatsanwalt Yves Bertossa anlässlich der Berufungsverhandlung in den Gerichtssaal, «und die Exekutoren exekutieren!» Unter diesem Motto lässt sich auch das Urteil zusammenfassen. Was Sperisen genau getan haben soll, liessen die Richter offen. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass die mutmasslichen Morde ohne Mitwissen des politischen Chefs geplant und vollstreckt worden waren.
Der abstruse Vorwurf, Sperisen habe Häftlinge eigenhändig erschossen, wurde in zweiter Instanz zwar fallengelassen. Während das Kriminalgericht dem Polizeichef noch eine aktive Teilnahme an den mutmasslichen Exekutionen unterstellte, warf ihm das Appellationsgericht das Gegenteil vor: Sperisens Passivität sei verräterisch gewesen, er habe sich weder für die Namen der Toten interessiert, noch habe er eine Untersuchung des Falles angeordnet.
Nun liegt bei den Gerichtsakten ein ganzer Strauss von Zeugnissen, der so bunt, verwirrend und undurchdringlich anmutet wie der guatemaltekische Dschungel. Viele Aussagen widersprechen sich. Nicht einmal Staatsanwalt Yves Bertossa mochte sich auf eine konkrete Version festlegen. Wann und wo Erwin Sperisen wem welche Befehle erteilt haben soll, geht weder aus der Anklage hervor, noch erfahren wir das aus dem Urteil. Irgendwie und irgendwann soll er sich mit Giammattei und Figueroa verschworen haben, um irgendwo irgendwem den Mordauftrag zu erteilen.
Das Perfide an Bertossas Anklage ist: Gegen einen Vorwurf, den man nicht genau kennt, kann man sich schlecht verteidigen. Die Verteidiger Florian Baier und Giorgio Campá legten sich zwar mächtig ins Zeug und deckten eine Ungereimtheit nach der anderen auf. Doch aus dem riesigen Berg von Berichten und Zeugnissen aus dem fernen Guatemala, deren Glaubwürdigkeit man nicht überprüfen kann, lässt sich alles Mögliche und Unmögliche konstruieren. Baier und Campá fanden auch Hinweise darauf, dass die guatemaltekischen Ermittler den Genfer Kollegen entlastende Elemente verheimlichten.
Sicher ist: Die internationale Organisation Cicig, welche 2008 die Ermittlungen vor Ort zusammen mit guatemaltekischen Staatsanwälten aufnahm, stand unter einem gewaltigen Erfolgsdruck. Ihr einziges Ziel, der «Kampf gegen die Straflosigkeit», verlangte nach einem schnellen Erfolg, zumal das Mandat der Cicig vorweg auf zwei Jahre beschränkt wurde. In der Not bediente man sich deshalb einer Methode, die in den USA üblich, in der Schweiz ebenso wie in Guatemala aber schlicht illegal ist: des Kronzeugendeals.
Wer gegenüber der Cicig einen Vorgesetzten anschwärzte, kam nicht nur in ein grosszügiges Zeugenschutzprogramm, er wurde auch mit Straffreiheit belohnt. Die Schuld wird bei diesem System in einer Kaskade von unten nach oben weitergereicht: Um den eigenen Kopf zu retten, schwärzt ein jeder den Nächsthöheren in der Hierarchie an. Vom kleinen Mitläufer arbeiten sich die Ermittler so hoch bis zum Big Boss, der am Ende für alle büssen soll. Was auf den ersten Blick bestechend erscheinen mag, ist in Wahrheit schlechterdings korrupt. Zu gross ist die Gefahr, dass ein Verdächtiger sein eigenes Verschulden verschleiert, indem er wider besseres Wissen einen Unschuldigen anschwärzt.
Im Fall von El Pavón ist die Gefahr von Falschanschuldigungen besonders virulent, da mangels zuverlässiger Sachbeweise die Zeugenaussagen ein übermässiges Gewicht erhalten. Kommt dazu, dass ein Polizist, der wegen der Ermordung von Häftlingen verurteilt wird, in einem guatemaltekischen Gefängnis eine geringe Lebenserwartung hat. Es ist wie bei der Folter: Die Todesangst beflügelt die Fantasie im gleichen Masse, wie die Hemmschwelle einer Falschanschuldigung sinkt. Erzwungene oder gekaufte Geständnisse und Anschuldigungen sind deshalb das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurden.
Kronzeugendeal
Wie aus dem Prozess in Österreich hervorging, offerierte Cicig-Ermittlerin Gisela Rivera dem Arzt und Sperisen-Stellvertreter Javier Figueroa einen grosszügigen Straferlass, wenn er gemäss ihrer Vorstellung aussagen würde. Sein «Geständnis» hatte sie gemäss der Zeitschrift Profil bereits verfasst, doch Figueroa weigerte sich, seine Unterschrift darunter zu setzen. 2009 setzt sich die Cicig-Ermittlerin überstürzt nach Costa Rica ab, ihrem Heimatland. Wegen Amtsgeheimnisverletzung, Nötigung und Begünstigung hat Guatemala Ermittlerin Rivera international zur Verhaftung ausgeschrieben. Doch das Verfahren gegen die angeblichen Pavón-Verschwörer war längst aufgegleist, die erpressten Anschuldigungen waren nicht mehr rückgängig zu machen.
Auch Alejandro Giammattei bekam einen Kronzeugendeal angeboten: eine Strafe von lediglich fünf Jahren Gefängnis, die nie würde vollzogen werden, gegen ein «Geständnis», das Innenminister Vielmann einbeziehen sollte. Er lehnte ab und nahm dafür ein Jahr Untersuchungshaft in Kauf. Leider weigerte sich das Genfer Gericht, Giammattei als Zeugen zu befragen. Er hätte das Verurteilen erschwert.
Extra nach Genf eingeflogen wurde dagegen der erwähnte Nachrichtendienstler Luis Linares Pérez, der den Sturm auf El Pavón geplant und die ominöse Liste der einflussreichsten Häftlinge erstellt hatte. Linares Pérez belastete hauptsächlich seinen Auftraggeber Giammattei sowie Figueroa, Sperisen kommt in seinen Aussagen nur am Rande vor. Selber will er mit der Verschwörung nichts zu tun haben, die er erst im Nachhinein entdeckt habe. Seltsamerweise war der angeblich unwissende Linares Pérez bei der Schiesserei vor dem Chalet von Drogenbaron Batres zugegen. Gemäss seiner Version gab er aber nur drei Schüsse ab. Danach hätten ihn die eigenen Leute zu Boden geworfen und entwaffnet.
Wie die Verteidiger Baier und Campá im Verlauf des Verfahrens zufällig entdeckten, war auch die Aussage von Linares Pérez durch einen Kronzeugendeal erkauft. Er lebt heute in Kanada. So fragwürdig die Aussagen des Geheimdienstlers sind – auf sie stützt sich der Vorwurf einer kriminellen Verschwörung zwischen Giammattei, Figueroa und Sperisen. Weil Sperisen nach dieser Version aber eine eher untergeordnete Rolle spielte, befand die Genfer Justiz die bereits rechtskräftig freigesprochenen Ärzte kurzerhand für schuldig. Anders konnte man Sperisen nicht verurteilen.
Am 26. März 2015, kurz vor der Berufungsverhandlung im Fall Sperisen, ehrte der Genfer Bürgermeister Sami Kanaan die linksalternative Organisation Trial wegen ihrer Verdienste bei der weltweiten Verfolgung politischer Kriminalität mit der Ehrenmedaille («Genève reconnaissante»). Als Teil eines internationalen NGO-Netzwerkes hatte die Organisation Trial das Verfahren gegen Sperisen in der Schweiz losgetreten und propagandistisch vorangetrieben. Als Erwin Sperisen vor die Schranken trat, stand sein Urteil längst fest. Das Bedürfnis nach einem Exempel war übermächtig.
* «El caso Giammattei» – Relato de una Injusticia; Guatemala 2012, ISBN978-9929-40-280-5
(Copyright: Die Weltwoche, Ausgabe-Nr. 45, Seite: 42)
4. «Wir sind den Opfern verpflichtet»
19. November 2015 - Ist der zu lebenslänglich verurteilte Erwin Sperisen Opfer einer politischen Hetzjagd? Philip Grant, Anwalt und Direktor der Organisation Trial, nimmt Stellung zu den Vorwürfen, welche die Weltwoche im Zusammenhang mit dem Prozess in Genf gegen seine Organisation erhoben hat.
Rechtsanwalt Philip Grant, der kürzlich vom Bürgermeister die Ehrenmedaille «Genève reconnaissante» entgegennehmen durfte, ist eine bekannte Persönlichkeit in der Rhonestadt. Seit dreissig Jahren setzt sich der einstige Dienstverweigerer, Friedens- und Asylaktivist für die juristische Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen rund um den Erdball ein. Bereits 1996 forderte er die Verhaftung des chilenischen Diktators Augusto Pinochet und dessen Auslieferung nach Genf.
Die 2002 von Grant mitbegründete und seither von ihm geleitete Nichtregierungsorganisation Trial war massgeblich am umstrittenen Verfahren gegen Erwin Sperisen beteiligt gewesen, den die Genfer Justiz im letzten Mai wegen eines Gefängnismassakers in Guatemala zu lebenslänglich verurteilte. Die Weltwoche kritisierte die Verquickung der Genfer Staatsanwaltschaft mit der Organisation Trial. Grant mochte die Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Er empfängt uns im Sitzungszimmer von Trial, einem schmucklosen Kellerraum im «Maison des associations socio-politiques». Dieses von linksalternativen Kreisen initiierte und von der Stadt Genf subventionierte Zentrum bietet auf über 3000 Quadratmetern Raum für rund sechzig Organisa- tionen, die sich sozialen, politischen und ökologischen Anliegen verpflichtet haben.
Die Genfer Justiz will Erwin Sperisen lebenslänglich hinter Gitter schicken. Maître Grant, Sie haben erreicht, was Sie wollten – zufrieden?
Ich freue mich nie, wenn ein Mensch ins Gefängnis muss. Aber ich glaube, die Justiz hat ihre Pflicht getan. Nach meiner Ansicht war es ein fairer Prozess.
Was macht Sie so sicher, dass Sperisen ein mehrfacher Mörder ist?
Trial war an der Strafuntersuchung der Genfer Staatsanwaltschaft nicht beteiligt, wir haben nur den öffentlichen Teil der Gerichtsverhandlungen verfolgt. Ich kenne die schriftliche Urteilsbegründung nicht, die Sie als widersprüchlich kritisieren, aber ich vertraue unserer Justiz.
Es erstaunt mich, dass Sie Ihre Rolle jetzt so kleinreden. Seit 2008 veranstaltet ein Netzwerk linker NGOs, zu dem auch Trial gehört, eine eigentliche Menschenjagd auf Sperisen. Am Anfang war der Fall «Finca Nueva Linda», ein komplizierter und blutiger Streit unter zwei Bauernorganisationen in Guatemala, ein Politikum, von dem heute niemand mehr spricht. Ohne Trial hätte es nie einen Prozess gegen Erwin Sperisen in der Schweiz gegeben.
Der Ablauf stimmt so nicht, wie Sie ihn beschreiben. Trial ist erst im Februar 2009 in den Fall Sperisen eingestiegen, nach aufwendigen Recherchen notabene. Mit dem Fall «Finca Nueva Linda» haben wir direkt nichts zu tun, uns ging es von Anfang an um die Exekutionen im guatemaltekischen Gefängnis El Pavón. Es waren andere NGOs, die im Juli 2007 eine Strafanzeige gegen Sperisen einreichten. Ich habe diese NGOs zwar später vertreten, aber nicht im Namen von Trial, sondern privat als Anwalt.
Trial präsentierte in einem Dokumentarfilm Maria del Socorro Vásquez als Mutter eines angeblichen Opfers von Sperisen; später fungierte diese Frau als angebliche Privatklägerin im Genfer Prozess. In einem auf Video aufgezeichneten Interview mit dem Journalisten Arnaud Bédat erklärt dieselbe Maria Vásquez aber kurz vor dem Prozess, sie habe keine Ahnung vom Genfer Verfahren, sie habe auch nichts gegen Sperisen. Ziemlich peinlich für Sie – oder?
Wir haben den ersten Kontakt zu dieser Frau hergestellt, danach lief alles direkt über die Anwältin Alexandra Lopez, die sie als Geschädigte im Genfer Prozess vertrat. Was dort lief, dazu kann ich nichts sagen, weil wir nicht mehr involviert waren. Was ich aber versichern kann: Wir haben das Opfer damals sehr genau informiert über den Prozess in Genf, die Risiken und Konsequenzen. Was danach lief, wissen wir nicht. Es ist sehr schwer zu beurteilen von hier aus. Wir wissen nicht, wie und unter welchen Umständen das Interview mit Bédat zustande kam, was vorher lief. Bédat war ja selber nur ein paar Tage in Guatemala, und man kann sich fragen, wie er die Frau gefunden hat. Dem Journalisten ging es nur um den Scoop, und das einen Tag vor dem Prozess. Das Genfer Gericht hat später auch bestätigt, dass ihre Anwälte korrekt bevollmächtigt waren.
Das Beispiel Maria Vásquez zeigt für mich: Es ist unmöglich, von Genf aus zu beurteilen, was im fernen Guatemala passiert ist.
Bei einem Beziehungsdelikt wissen Sie auch nie genau, was zwischen zwei Partnern passiert ist. Man wird es vielleicht auch in einem Prozess nie genau herausfinden. Die Justiz muss trotzdem aufgrund von Aussagen und Indizien ein Urteil fällen. Im Fall Sperisen gab es viele Aussagen, Fotos und Fakten, und ich vertraue darauf, dass die Richter diese richtig ausgewertet haben. Gerade dieser Fall zeigt, dass es geht. Wir müssen nicht die soziokulturellen und ökonomischen Umstände von Guatemala beurteilen, sondern die Frage, ob jemand einen Mord zu verantworten hat oder nicht. Es wäre sicher einfacher gewesen, Sperisen in Guatemala vor Gericht zu bringen. Nur konnte man ihn als Schweizer Bürger nicht ausliefern. Also hat man ihm in der Schweiz den Prozess gemacht. Was hätte man denn sonst tun sollen? Die Morde ignorieren?
Sicher nicht. Aber die Genfer Justiz stützt sich auf eine Untersuchung aus Guatemala, die zahllose Mängel aufweist und die auf Kronzeugendeals baut, die in der Schweiz schlicht illegal sind, weil es sich um erpresste Anschuldigungen und erkaufte Pseudogeständnisse handelt, denen man niemals trauen darf. Wie können Sie als Anwalt derartige Machenschaften billigen?
Gerade die Mängel bei der guatemaltekischen Justiz können auch ein guter Grund dafür sein, den Fall vor ein Gericht im Ausland zu bringen, sei das nun in der Schweiz oder anderswo. Kronzeugen sind sicher problematisch. Ich kenne das schriftliche Urteil wie gesagt nicht, aber es baut bestimmt nicht allein auf Kronzeugen. Zeugenschutzprogramme sind auch in der Schweiz zulässig; ein plea bargaining, also ein Straferlass bei Kooperationsbereitschaft, ist auch hierzulande unter Umständen möglich. Nun, wir werden sehen, was das Bundesgericht zum Genfer Urteil im Fall Sperisen sagt. Das Echo der meisten Prozessbeobachter war positiv.
Sie tun jetzt schon wieder so, als hätten Sie nichts mit dem Fall zu tun. In Wahrheit war das Ihr Prozess, den Sie angestossen und bis zum Ende begleitet haben.
Wir haben an den Anfängen mitgewirkt, in Zusammenarbeit mit anderen NGOs, das stimmt. Als das Verfahren aber einmal lief, waren wir sehr zurückhaltend. Wir haben lediglich auf unserer Website, meiner Meinung nach sehr nüchtern, über das Verfahren berichtet. Wir haben nie Propaganda damit betrieben und wir haben auch nicht mit der Privatklägerin «spendenwirksam hausiert», wie Sie zu Unrecht behaupten. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass wir einen fairen Prozess wollen.
Es gab in Genf einige namhafte Kritiker. Catherine Focas zum Beispiel, Gerichtsreporterin der Tribune de Genève, schrieb von «Kolonialjustiz». Wollen Sie von Genf aus den Weltpolizisten spielen?
Der Begriff «Kolonialjustiz» ist in diesem Kontext absolut grotesk. Ein Polizeichef hat in Guatemala genauso wenig das Recht zu töten wie in der Schweiz. Sperisen wollte sich nicht der Justiz von Guatemala stellen. Soll er deshalb einfach straffrei bleiben? Stellen Sie sich vor, es wäre umgekehrt: Ein Ausländer wird eines schweren Deliktes in der Schweiz verdächtigt und setzt sich in seine Heimat ab. Wir würden auch verlangen, dass er dort belangt wird.
Die Hauptverdächtigen Alejandro Giammattei und Javier Figueroa wurden aber in Guatemala beziehungsweise in Österreich rechtskräftig freigesprochen. Letzterer bekam sogar Asyl als politisch Verfolgter – in exakt demselben Fall, in dem Sperisen als vermeintlicher Mittäter verurteilt wurde. Absurder geht es nicht mehr.
Die Chronologie hätte auch umgekehrt sein können: dass Sperisen zuerst verurteilt wird und die andern freigesprochen werden. Ich kann die Prozesse in Österreich und in Guatemala nicht beurteilen. Die Möglichkeit besteht immer, dass verschiedene Gerichte zu unterschiedlichen Beurteilungen gelangen.
Sperisen wurde verurteilt, weil es in Genf, anders als in Österreich, ein politischer Prozess war – und zwar von dem Tag an, als Staatsanwalt Yves Bertossa (SP) den Fall übernahm und Sperisen verhaften liess.
Das stimmt nicht. Von beiden Seiten wurde hart gekämpft. Die Verteidiger versuchten immer wieder, Bertossa wegen angeblicher Befangenheit aus dem Verfahren zu drängen, bis hinauf zum Bundesgericht, immer erfolglos. Vielleicht hätten sich die Anwälte mehr auf den Inhalt konzentrieren sollen statt auf die Diffamierung des Anklägers. Natürlich gehört Yves Bertossa einer Partei an, wie alle Staatsanwälte. Zwar gehöre auch ich dieser Partei an, der SP, aber das ist es dann auch schon. Es gibt keine private Beziehung zwischen uns, wie Sie insinuieren.
Auch Sie sagen stets, Sie seien neutral. Ich kaufe Ihnen das nicht ab. Sie sind Teil eines internationalen Netzwerkes von NGOs, die alle offensichtlich nach links tendieren.
Und Sie schreiben für ein Magazin, dessen Besitzer und Chefredaktor soeben für die SVP in den Nationalrat gewählt worden ist und der schon lange markant rechte Positionen vertritt. Soll ich Ihnen deshalb unterstellen, Sie seien als Journalist unglaubwürdig und einseitig? Jeder Mensch hat eine Weltanschauung. Aber man kann ihm doch deshalb nicht unterstellen, dass er nicht zwischen Politik und Rechtsprechung unterscheidet – ohne den Beweis zu erbringen. Das stört mich sehr an Ihren Berichten, die sehr einseitig und stellenweise unwahr sind; mit uns haben Sie gar nicht geredet.
Dann klären Sie uns jetzt auf – Sie bestreiten also, dass Trial eine linke NGO ist?
Natürlich. Trial ist gemäss Statuten ein apolitischer Verein. Schauen Sie sich die Fälle an, die wir weltweit verfolgen. Wenn Menschenrechtsverletzungen begangen werden, interessiert uns wirklich nicht, ob die Täter von links oder von rechts kommen. Wir sahen uns nie als politische Organisation, sondern als eine Art Anwaltskollektiv. Wir sind allein den Opfern verpflichtet.
(Das Interview führte Alex Baur; Copyright: Die Weltwoche Ausgabe-Nr. 47, Seite 50)
5. Verschwörer ohne Komplizen
23. März 2017 - Seit bald fünf Jahren sitzt Erwin Sperisen wegen eines angeblichen Mordkomplotts im fernen Guatemala in Genf in Untersuchungshaft. Nun ist in Spanien der letzte vermeintliche Mitverschwörer freigesprochen worden. Für die Genfer Justiz zeichnet sich ein Debakel ab.
Das Verdikt der Audiencia Nacional in Madrid vom 15. März 2017 liess an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: «Der Beschuldigte war weder an der Exekution von Gefangenen beteiligt, noch hat er eine solche angeordnet, gebilligt oder unterstützt, noch hatte er Kenntnis davon, noch konnte er eine solche voraussehen oder verhindern.» Das spanische Gericht sprach damit den ehemaligen guatemaltekischen Innenminister Carlos Vielmann frei von Schuld und Strafe in einem internationalen Fall, über den seit zehn Jahren gestritten wird, unter anderem auch in Genf.
Das «Massaker von El Pavón» gilt unter Drittwelt-Aktivisten als Fanal rechter Gewalt und Willkür in Guatemala. Im September 2006 hatten 2500 Polizisten und Soldaten ein von Drogen- und Gangsterkartellen kontrolliertes Gefängnis in Guatemala City mit 1800 Insassen gestürmt. Sieben Häftlinge wurden dabei erschossen, und zwar – so der Verdacht – nachdem sie sich ergeben hatten. Unter dem Druck einer weltweit orchestrierten NGO-Kampagne bezichtigte eine Sonderkommission (Cicig) ehemalige Spitzenpolitiker und Chefbeamte eines Mordkomplotts.
Der Freispruch von Madrid betrifft den letzten und prominentesten Angeklagten, den vermeintlichen Chef der Verschwörung. Zwar trug Innenminister Carlos Vielmann nach Ansicht der spanischen Richter die politische Hauptverantwortung, doch es gehe nicht an, allein daraus auch auf eine strafrechtliche Verantwortung zu schliessen.
Die Komplott-Theorie stützt sich auf Aussagen von Kronzeugen und ist über die Jahre dahingeschmolzen wie ein Häufchen Eis in der Frühlingssonne. Strafvollzugschef Alejandro Giammattei und sein Stellvertreter Mario García Frech wurden bereits 2010 in Guatemala freigesprochen. 2013 folgte in Österreich der Freispruch von Javier Figueroa, dem operativen Chef der guatemaltekischen Nationalpolizei (PNC). Figueroa erhielt in der Folge politisches Asyl.
Fall verstaubt am Bundesgericht
Erwin Sperisen, der politische Chef der PNC, verbleibt damit als einziger vermeintlicher Verschwörer. Im August 2012 wurde er in Genf verhaftet, seither schmort er im Untersuchungsgefängnis Champ-Dollon. Im Juli 2015 verurteilte das Genfer Strafgericht den Nachkommen von Schweizer Auswanderern aus dem Solothurnischen zweitinstanzlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Zwar geht aus dem Urteil nicht hervor, welchen Tatbeitrag Sperisen konkret geleistet haben soll. Doch die Genfer Richter konnten sich nicht vorstellen, dass die vermeintliche Verschwörung ohne ihn stattgefunden haben könnte.
Seither verstaubt der Fall unerledigt beim Bundesgericht. In einer mehrteiligen Serie förderte die Weltwoche im Herbst 2015 zahlreiche Unstimmigkeiten im Verfahren zutage. So verurteilten die Genfer Richter etwa die vermeintlichen Komplizen Giammattei, García, Figueroa und Vielmann explizit als Mittäter – ohne dass sie sich je gegen diese Vorwürfe hätten wehren können. Doch ohne Verschwörung, die es gemäss den Freisprüchen von Guatemala und Österreich nie gegeben hat, konnte man Sperisen nicht verurteilen.
Mit dem Vielmann-Freispruch in Madrid fällt neben Sperisens Untergebenen nun auch noch der Kopf des angeblichen Komplotts weg. Erwin Sperisen müsste sich mit sich selber verschworen haben, spotten seine Verteidiger Florian Baier und Giorgio Campa. Zwar sind die Urteile aus dem Ausland nicht bindend für die Schweiz. Doch Vielmann und Figueroa wurden von Vertragsstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) rehabilitiert. Und diese verbietet es, Freigesprochene für das gleiche Delikt anderswo zu verurteilen.
Anders als die Genfer brauchten die spanischen Richter keine Übersetzer. Den wichtigsten Kronzeugen der Anklage – den Geheimdienstler Luis Linares, der seine Aussagen mehrfach revidierte, um seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen – stufte die Audiencia Nacional als völlig unglaubwürdig ein. Doch Linares belastet Sperisen bloss indirekt, via Vielmann. Fällt Vielmann weg, fällt auch der Rest der Verschwörung in sich zusammen.
Baier und Campa fordern nun die sofortige Freilassung von Erwin Sperisen, der seit bald fünf Jahren in Untersuchungshaft sitzt. Da er von Anfang an kooperativ war und sich sogar aus eigenen Stücken gestellt hatte, sei die Fluchtgefahr gering. Wiederholungs- oder Verdunkelungsgefahr besteht erst recht nicht. Andere Haftgründe gibt es nicht.
Das Bundesgericht befindet sich in der Zwickmühle. Allein schon der Freispruch aus Madrid wäre Grund genug für eine Revision des ganzen Strafverfahrens. Ein Freispruch wäre andererseits eine gewaltige Ohrfeige an die Adresse der Genfer Justiz. Wiedergutmachung in Millionenhöhe würde fällig. Und es wäre beileibe nicht das erste Mal, dass Genf in einem politisch geladenen Strafprozess eine hohe Entschädigung zahlen muss. Doch je länger das Bundesgericht den peinlichen Entscheid vor sich herschiebt, desto schmerzvoller wird der Freispruch – aber auch desto teurer.
(Copyright: Die Weltwoche, Ausgabe-Nr. 12, Seite 37)
6. Aufstand der Rechtsprofessoren
01. Juni 2017 -Seit bald fünf Jahren sitzt Erwin Sperisen, der ehemalige Polizeichef von Guatemala, in Genf ohne rechtskräftiges Urteil in Untersuchungshaft. Namhafte Strafrechtler kritisieren den Verstoss gegen die Unschuldsvermutung und erinnern an das Beschleunigungsgebot. Von Alex Baur
Im «Mon-Repos», dem Sitz des Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne, geht man die Dinge gern gemächlich an. Seit August 2012 schmort der ehemalige Polizeichef von Guatemala ohne rechtsgültiges Urteil im Genfer Untersuchungsgefängnis Champ-Dollon. Es geht um eine lebenslängliche Strafe für ein Massaker, das sich 2006 in einem guatemaltekischen Gefängnis zugetragen haben soll – oder aber um eine Entschädigung in Millionenhöhe für fünf lange Jahre unschuldig erlittene Untersuchungshaft. Dazwischen ist nichts. Doch seit bald zwei Jahren lagert der Fall im «Mon-Repos». Die jüngste Beschwerde von Sperisens Anwälten beim Bundesgericht gegen die Haft richtet sich deshalb nicht nur gegen die Genfer Justiz. Das Bundesgericht wird auch über sich selber richten müssen.
Nun erhalten die Verteidiger überraschend Support von namhaften und vor allem auch unverdächtigen Strafrechtlern: Professor und Ständerat Daniel Jositsch (SP) aus Zürich sowie Professor Christian-Nils Robert, ein Spezialist für Menschenrechte aus Genf. Dass sich zwei bekanntermassen linke Rechtswissenschaftler im Fall Sperisen exponieren, mag überraschen. Doch den beiden geht es nicht um Politik, sondern um grundlegende Fragen eines fairen Prozesses: das Recht auf eine angemessene Verteidigung, der Schutz vor Willkür, die Unschuldsvermutung, eine vernünftige Dauer des Verfahrens. Und davon kann nach fünf Jahren kaum noch die Rede sein.
Jositsch befasst sich in einem Rechtsgutachten mit der Frage, ob sich die Schweizer Justiz auf die Aussagen eines guatemaltekischen Kronzeugen stützen durfte. Konkret geht es um den ehemaligen Geheimdienstler Luis Linares Pérez, der für seine Anschuldigungen mit Straffreiheit und einem kanadischen Visum belohnt wurde. Diese richteten sich zwar vor allem gegen den damaligen guatemaltekischen Innenminister Carlos Vielman, waren aber entscheidend im Fall Sperisen.
In einer differenzierten Abwägung schliesst Jositsch eine Verwertung dieser Aussagen nicht a priori aus. In der Schweiz sind Kronzeugenregelungen zwar verboten, weil die Gefahr einer gekauften oder erpressten Falschanschuldigung zu gross ist. Will man sich auf einen Kronzeugen aus dem Ausland stützen, müssten die Umstände und der Deal, mit denen die Anschuldigungen belohnt wurden, deklariert und dokumentiert sein. Genau das fehlt im vorliegenden Fall aber.
Innenminister Vielman, der direkte Vorgesetzte von Sperisen, wurde bereits im letzten März in einem Parallelprozess in Madrid freigesprochen («Verschwörer ohne Komplizen», Weltwoche Nr. 12/17). Im spanischen Urteil, dessen schriftliche Begründung mittlerweile vorliegt, wird die belastende Aussage des Kronzeugen Linares Pérez als «völlig unglaubwürdig» disqualifiziert.
Ein zweiter vermeintlicher Mitverschwörer, Javier Figueroa, der operative Chef der guatemaltekischen Polizei, wurde schon früher in Österreich freigesprochen. Sperisen, der hierarchisch zwischen Vielman und Figueroa stand, verbleibt damit als einziger Beschuldigter in einer angeblichen Verschwörung, die es nach dem spanischen Verdikt nie gegeben hat. Die ursprünglich eingeklagte Version, laut der Sperisen beim Gefängnismassaker selber geschossen hätte, hat die Genfer Justiz bereits vor zwei Jahren als Hirngespinst entlarvt.
Flucht wäre für Sperisen gefährlicher
Hier liegt gemäss Professor Christian-Nils Robert der Kern des Problems. Als der Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa im August 2012 Erwin Sperisen verhaften liess, stützte er sich auf einen französischen Zeugen, dessen Aussagen längst widerlegt sind. Indem er die Untersuchungshaft trotzdem fortsetzte, setzte Bertossa sich selber und die Justiz unter Erfolgsdruck. Während alle anderen vermeintlichen Mitverschwörer längst wieder auf freiem Fuss waren, blieb Sperisen weiter in Haft. Dabei hätte es gereicht, den Angeschuldigten bis zum Ende des Verfahrens unter Hausarrest zu setzen, eventuell mit einer Fussfessel. Eine Wiederholungs- oder Verdunkelungsgefahr liegt gemäss Robert schon lange nicht mehr vor. Die Haft sei unverhältnismässig.
Staatsanwalt Bertossa machte vor Bundesgericht Fluchtgefahr geltend. Tatsächlich ist man von Genf aus schnell in Frankreich. Die Verteidiger halten dem entgegen, dass Sperisen im Ausland eine viel grössere Gefahr drohe als in der Schweiz: eine Auslieferung nach Guatemala, wo das ganze Verfahren allenfalls neu aufgerollt würde. Nachdem alle vermeintlichen Mitverschwörer freigesprochen worden sind, wäre es besonders dumm, sich der Schweizer Justiz zu entziehen. Die Freisprüche aus Spanien und Österreich seien zwar nicht bindend für die Schweiz, aber gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) könne sich die Schweiz auch nicht einfach darüber hinwegsetzen. Erwin Sperisen habe vielmehr ein grosses Interesse, dass endlich ein Urteil gefällt werde: in Lausanne – oder dann halt in Strassburg.
(Copyright Weltwoche Ausgabe-Nr. 22/2017, Seite 33)
7. Geheimdeal um lebenslänglich
06. Juli 2017 - Die Genfer Staatsanwaltschaft bot dem vermeintlichen Massenmörder Erwin Sperisen einen Geheimdeal an: fünf Jahre Gefängnis, wenn er irgendein Geständnis ablege und andere beschuldige.
Seit fast fünf Jahren schmort Erwin Sperisen in Genf ohne rechtsgültiges Urteil in Untersuchungshaft. Der Verdacht: Als Polizeichef von Guatemala soll Sperisen 2006 ein Gefängnismassaker befohlen haben. Bisher blockte der für den Fall zuständige Staatsanwalt Yves Bertossa jeden Kontakt des prominenten Untersuchungshäftlings mit den Medien ab. Dem Magazin L’Illustré ist es nun erstmals gelungen, den Bann zu brechen und Sperisen im Hochsicherheitstrakt von Champ-Dollon zu befragen.
Im Interview erzählt Sperisen, wie er nach seinem Rücktritt als Polizeichef 2007 von den allmächtigen Drogenkartellen bedroht wurde. Zuerst schickte er seine Familie in die USA, dann in die Schweiz, die Heimat seiner Vorfahren. Schliesslich liess sich die Familie in Genf nieder, wo Sperisens Vater bis heute als Botschafter von Guatemala bei der Uno tätig ist. Selber reiste er erst später nach.
Linke Drittweltisten erheben Anklage
Bereits 2009 nahmen linke Genfer Drittweltorganisationen, sogenannte NGOs, Erwin Sperisen wegen angeblicher Polizeiübergriffe im fernen Guatemala ins Visier. Dieser meldete sich umgehend bei der Genfer Staatsanwaltschaft und beteuerte seine Unschuld. Als Doppelbürger konnte Sperisen nicht ausgeliefert werden, trotzdem sicherte er seine Kooperation zu. Der damalige Generalstaatsanwalt Daniel Zapelli winkte ab. Doch 2011 wurde Zapelli aus dem Amt gemobbt, während Yves Bertossa zum Ersten Staatsanwalt befördert wurde. Zusammen mit der NGO Trial wollte Bertossa am Fall Sperisen ein Exempel statuieren und der Welt zeigen, wie man Justiz macht.
Ein Jahr später stöberte Trial – vom Kanton Genf gesponsert – den in Guatemala verurteilten französischen Mörder Philippe Biret auf. Dieser behauptete, mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie Sperisen Häftlinge erschossen habe. Aufgrund dieser Behauptung liess Bertossa im August 2012 Sperisen verhaften. Allerdings zeigte sich spätestens bei der zweiten Einvernahme, dass Birets Beschuldigungen voller Widersprüche waren. Vieles weist darauf hin, dass sich der Mörder mit den Falschanschuldigungen gegen Sperisen in Guatemala die Freiheit erkauft hatte. Das würde zur ganzen Untersuchung passen.
Die guatemaltekische Sonderkommission (Cicig), die das Gefängnismassaker untersuchte, setzte hemmungslos auf sogenannte Kronzeugendeals. Verdächtigte, die einen anderen Verdächtigen, am besten einen Vorgesetzten, als Drahtzieher beschuldigten, kamen straffrei weg. Das Resultat war ein heilloses Chaos an wilden Anschuldigungen. Doch für die Cicig war von Anfang an klar: Schuldig waren die politischen Vorgesetzten. Polizeichef Sperisen soll sich mit seinem Stellvertreter Javier Figueroa und dem damaligen Innenminister Carlos Vielmann zu einem Mordkomplott verschworen haben.
Vielmann und Figueroa, die sich ebenfalls ins Ausland abgesetzt hatten, wurden in der Zwischenzeit in Spanien und Österreich freigesprochen (Letzterer bekam sogar politisches Asyl). Die Cicig-Ermittlerin Gisele Rivera, die das Kronzeugenchaos mit angerichtet hatte, wurde inzwischen in Guatemala selber zur Verhaftung ausgeschrieben, weil sie Zeugen genötigt und zu falschen Anschuldigungen gedrängt haben soll.
Doch die Genfer interessierte das nicht. Bertossa hielt an seiner Verschwörungstheorie fest. Und er hatte damit bei den Genfer Gerichten bislang Erfolg. Im Juli 2015 verurteilte das Obergericht Sperisen wegen eines Mordkomplotts mit den (im Ausland freigesprochenen) vermeintlichen Mitverschwörern Vielmann und Figueroa zu «lebenslänglich». Der Fall liegt nun seit bald zwei Jahren am Bundesgericht.
Strafjustiz als Pokerspiel
Nun enthüllt Erwin Sperisen im Interview mit L’Illustré Prozessinterna, welche nahelegen: Bertossa selber glaubte nicht an seine Mordtheorie. Im Januar 2013 schlug er Sperisen nämlich einen Geheimdeal vor: Wenn dieser sich in irgendeinem Nebenpunkt für schuldig erkläre und andere belaste, begnüge er sich mit fünf Jahren Gefängnis. In drei Jahren würde Sperisen in diesem Fall bei guter Führung freikommen – sonst müsse er mit «lebenslänglich» rechnen. Sperisen lehnte ab.
Die Justiz als Pokerspiel? Das «abgekürzte Verfahren» erlaubt solche erpresserischen Geheimdeals. Die Verteidiger von Erwin Sperisen bestätigten auf Anfrage der Weltwoche das indezente Angebot von Yves Bertossa. Der Genfer Staatsanwalt selber wollte dazu keine Stellung nehmen.
(Copyright Weltwoche, Ausgabe-Nr. 27/2017, Seite: 42)
8. Politischer Häftling
20. Juli 2017 - Die Kritik des Bundesgerichts am Urteil gegen Erwin Sperisen öffnet Abgründe. Im Namen der Menschenrechte wurden in Genf die Menschenrechte mit Füssen getreten.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist Erwin Sperisen vielleicht schon ein freier Mann. Vielleicht geht der Justiz-Albtraum aber auch weiter für den dreifachen Familienvater, der nun schon seit fünf Jahren in Untersuchungshaft sitzt, ohne Perspektiven und ohne rechtsgültiges Urteil, allen Rügen und Ermahnungen des Bundesgerichts zum Trotz. Bei Redaktionsschluss stand der Entscheid der «Chambre pénale d’appel et de révision» über das Haftentlassungsgesuch von Sperisen noch aus. Doch zusehends wird der Fall auch zum Albtraum für die Genfer Justiz.
Die krassen Ungereimtheiten und Mängel im Mordprozess gegen Erwin Sperisen hat die Weltwoche schon in einer Serie von Artikeln aufgezeigt («Die Genfer Konfusion», Ausgabe Nr. 43/2015). Das Bundesgericht hat diese Kritik letzte Woche in den zentralen Punkten bestätigt. Und augenreibend fragt man sich: Wie ist es möglich, dass in der Schweiz ein Mensch fünf Jahre lang in Untersuchungshaft schmort – ohne handfeste Beweise, aufgrund einer lückenhaften und politisch verseuchten Strafuntersuchung im fernen Guatemala?
Im August 2012 präsentierte ein linkes Hilfswerk dem Staatsanwalt Yves Bertossa einen ehemaligen Strafgefangenen, einen Mörder. Dieser will gesehen haben, wie Erwin Sperisen als Polizeichef von Guatemala 2006 bei einer Gefängnisrazzia Häftlinge eigenhändig exekutiert haben soll. Seither sitzt Sperisen in Haft. Doch spätestens bei der zweiten Einvernahme musste Bertossa erkannt haben, dass der vermeintliche Augenzeuge log. Mit der Aussage gegen Sperisen hatte der Mörder mutmasslich in Guatemala seine Freilassung erkauft. Doch statt die Übung abzubrechen und ein Verfahren wegen Falschanschuldigung zu eröffnen, trat Bertossa die Flucht nach vorne an. Und die Genfer Justiz folgte ihm blind.
Mit der U-Haft stieg der Erfolgsdruck
Je länger die Untersuchungshaft dauerte, desto grösser wurde der Druck auf die Genfer Justiz, den Guatemalteken mit Schweizer Wurzeln zu verurteilen — koste es, was es wolle. Die Urteile, die dabei entstanden sind, widersprachen sich zum Teil gegenseitig diametral. Mit Zirkelschlüssen und ausschweifenden Formulierungen wurden die Löcher und Widersprüche in der Beweisführung vernebelt. Man mochte sich nicht einmal darauf festlegen, wann Sperisen wem den Mordauftrag erteilt haben soll. Er war der Chef der Polizei, also war er verantwortlich. Denn moralisch wähnten sich die Genfer stets im Recht.
Von Genf aus, der gefühlten Welthauptstadt der Menschenrechte, wollte man im fernen Guatemala für Recht und Ordnung sorgen. Am Anfang sah es gut aus. Doch eine Justiz gibt es nicht nur in Genf. Zug um Zug wurden in Österreich, Spanien und in Guatemala alle Vorgesetzten und Untergebenen freigesprochen, mit denen sich Sperisen zum Mordkomplott verschworen haben soll. Dabei kamen Details aus den Ermittlungen in Guatemala ans Tageslicht, die diese als politisch motivierte Farce entlarven: Zeugen wurden gekauft und erpresst; was nicht zur Verschwörung passte, wurde unterdrückt. So gesehen, ist Sperisen ein politischer Gefangener.
Im Namen der Menschenrechte
Mit doppelter Wucht fällt die vermeintliche Lektion damit auf den Absender zurück. Nicht nur in Ankara oder Minsk schmoren politische Häftlinge jahrelang in Untersuchungshaft. Im Namen der Menschenrechte wurden in Genf die Menschenrechte von Erwin Sperisen mit Füssen getreten. Nur gab es hier deshalb keine Bürgerproteste, keine Petitionen, keine «Free Sperisen»-Konzerte.
Das Bundesgericht hat die Genfer Justiz nun aus dem Dämmerschlaf der Selbstgerechten gerissen. Der pensionierte Bundesgerichtspräsident Claude Rouiller qualifizierte die Rügen aus Lausanne öffentlich als «ungewohnt hart», die Verteidigungsrechte von Sperisen seien «grobschlächtig verletzt» («grossièrement violés») worden. Professor Christian-Nils Robert, ein politisch unverdächtiger Spezialist für Menschenrechte, rügte vor allem die überlange Untersuchungshaft scharf.
Auf den ersten Blick erscheint das rekordverdächtig hundert Seiten dicke Urteil des Bundesgerichts für Aussenstehende so unübersichtlich wie die vorinstanzlichen Entscheide. Die Rügen nach Genf sind gut versteckt im Wust von Nebensächlichem, aber sie sind fundamental: willkürliche Begründung und Würdigung von Beweisen, Missachtung von Anklageprinzip und Verteidigerrechten; während die Anhörung von Entlastungszeugen verweigert wurde, stützt sich der Schuldspruch auf Zeugen, die das Bundesgericht aus dem Recht weist. Und vor allem: Gemäss dem Urteil wurde die Unschuldsvermutung nicht nur in Bezug auf Erwin Sperisen verletzt, sondern auch in Bezug auf die freigesprochenen vermeintlichen Mittäter. Doch ohne Mitverschwörer fällt die Komplott-These in sich zusammen wie ein Kartenhaus.
Die in Watte verpackte, inhaltlich aber unmissverständliche Rückweisung aus Lausanne zwingt die Genfer Justiz, den Fall Sperisen in eigener Regie neu aufzurollen, aber diesmal unter Achtung des Rechts. Der einzig denkbare Haftgrund, Fluchtgefahr, fällt damit weg. Erwin Sperisen hat nach dem Urteil des Bundesgerichts jedes Interesse, in Genf zu bleiben und seine Rehabilitierung zu erstreiten. (Alex Baur)
(Copyright Weltwoche, Ausgabe-Nr. 29/2017, Seite 9)
9. Bertossas Rückzugsgefecht
28. September 2017 - Nach fünf Jahren Untersuchungshaft musste die Genfer Justiz Erwin Sperisen am letzten Montag auf Befehl des Bundesgerichts freilassen. Der Prozess geht weiter. Doch die Ausgangslage hat sich dramatisch geändert. Von Alex Baur
Wässrige Augen, die unsicher im Sonnenlicht blinzeln und misstrauisch nach Halt suchen, bleiche Haut, ein zerzauster Bart – der Mann, der am 25. September in Genf vor laufenden Kameras das Untersuchungsgefängnis Champ-Dollon hinter sich liess, er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Fünf Jahre Isolationshaft haben auf dem Gesicht von Erwin Sperisen, dem ehemaligen Polizeichef von Guatemala, deutliche Spuren hinterlassen. Auch wenn ein Schweizer Gefängnis schwerlich mit einem guatemaltekischen Knast zu vergleichen ist, wo die Tragödie ihren Anfang nahm vor exakt elf Jahren, am 25. September 2006.
Vorwurf Willkür
Die Tragödie ist damit noch lange nicht zu Ende. Nach wie vor lastet der Verdacht auf Sperisen, als politischer Chef der Nationalpolizei anlässlich einer Grossrazzia mit 2500 Einsatzkräften (Soldaten, Polizisten, Wärter, Geheimagenten) im Megagefängnis «El Pavón» (1800 Insassen) in Guatemala die Exekution von sieben Häftlingen wahlweise kommandiert oder angeordnet, vielleicht aber auch nur toleriert oder vertuscht zu haben. Was er genau getan, veranlasst oder unterlassen haben soll, bleibt nebulös. Weder Staatsanwalt Yves Bertossa noch die beiden Genfer Gerichtsinstanzen, die Sperisen mit unterschied- lichen Begründungen zu «lebenslänglich» verurteilten, mochten sich auf eine konkrete Version festlegen. Vom Tisch ist lediglich der ursprüngliche Vorwurf, gemäss dem der Chef die Männer eigenhändig erschossen haben soll.
Wegen diverser Mängel – Verletzung von Anklageprinzip, Un- schuldsvermutung und Verteidigerrechten, Willkür in der Beweiswürdigung – hob das Bundesgericht im letzten Juli den Schuldspruch auf. Glaubt man dem Tages-Anzeiger vom 28. Juni 2017, der sich die Meinung von Staatsanwalt Yves Bertossa zu eigen machte, geht es bloss um Formalitäten, die in einem neuen Prozess zu korrigieren wären. Wörtlich schreibt der Tagi: «Das Bundesgericht zweifelt nicht daran, dass er [Sperisen] die ihm zur Last gelegten Morde verübt hat.»
Richtig ist: Das Bundesgericht zweifelt nicht daran, dass Häftlinge exekutiert wurden. Die Kernfrage ist aber eine ganz andere, und die hat Lausanne offengelassen: Gab es eine Verschwörung auf höchster Ebene, und wenn ja, war Sperisen involviert? Da seine vermeintlichen Mitverschwörer, Vorgesetzte wie Untergebene, inzwischen in Guatemala, Spanien und Österreich allesamt freigesprochen wurden, müsste sich Sperisen mit sich selber verschworen haben. Denn das Bundesgericht hat unter anderem festgehalten: Die Genfer Justiz kann sich nicht einfach über die Freisprüche im Ausland hinwegsetzen.
Mit Sperisens Freilassung hat das Bundesgericht bekräftigt, dass es nicht bloss um Formalitäten geht. Der Verdacht bleibt wohl bestehen, doch die Beweislage ist so schwach, dass sie die Untersuchungshaft trotz der Schwere der Verbrechen nicht mehr rechtfertigt. Die Ausgangslage für die auf den 28. November anberaumte Neuauflage des Prozesses in Genf hat sich damit dramatisch verändert.
Vier Zeugen – zwei spanische Ermittler und zwei ehemalige guatemaltekische Häftlinge – sollen in Genf vor Gericht unter Wahrung der Verteidigerrechte neu einvernommen werden. Grundlegend neue Erkenntnisse sind von ihnen kaum zu erwarten. Dass die Einschätzungen der Ermittler keinen direkten Beweiswert haben, hat das Bundesgericht bereits festgehalten. Der eine guatemaltekische Zeuge hat sich durch krass widersprüchliche Aussagen auch ohne Zutun der Verteidiger bereits selber desavouiert, der andere liefert nicht mehr als ein Indiz.
Wie sich bei den Verfahren um die Untersuchungshaft abzeichnete, könnte Bertossa den Mordvorsatz fallen lassen, um auf eine mildere Form der Komplizenschaft (Begünstigung, Verletzung der Amtspflicht) zu plädieren. Einen Versuch in diese Richtung unternahm der Staatsanwalt bereits Anfang 2013, als er Sperisen ein sogenanntes plea bargaining anbot: Wenn er sich in irgendeinem Nebenpunkt für schuldig erkläre und andere anschwärze, werde die Anklage im Hauptpunkt fallengelassen (Weltwoche Nr. 27/2017, «Geheimdeal um lebenslänglich»). Mit diesem Trick hätte sich die Untersuchungshaft postum rechtfertigen lassen – und dem Kanton Genf blieben Genugtuung und Schadenersatz für die unschuldig erlittene Haft in sicher fünf-, möglicherweise aber auch sechsstelliger Höhe erspart.
Richter urteilen über Richter
Mit Rechtsfindung haben solche Manöver nicht mehr viel zu tun, sie dienen allein der Gesichtswahrung. Doch Staatsanwalt Yves Bertossa ist nicht der Einzige, der sich im politisch kontaminierten Haftfall Erwin Sperisen weit aus dem Fenster lehnte. Auch das Prestige von Gerichtspräsidentin Alessandra Cambi Favre-Bulle und ihrer Kollegen von der Cour pénale steht zur Disposition. Trotz prekärer Beweislage verurteilten sie Sperisen zu «lebenslänglich» und schmetterten jedes Gesuch um Haftentlassung ab, selbst als das Bundesgericht sein Veto einlegte. Es sind dieselben Richter, die Ende November ein neues Urteil fällen sollen. Sie werden wohl oder übel auch über sich selber zu Gerichte sitzen.
(Copyright Weltwoche, Ausgabe-Nr. 39/2017, Seite 32)
10. «Ein Albtraum, der nie enden will»
21. Dezember 2017 - Nach fünf Jahren Untersuchungshaft wurde Erwin Sperisen im September auf Befehl des Bundesgerichts freigelassen. Der Ex-Chef der guatemaltekischen Polizei spricht über seine Beziehung zur Schweiz, 1849 Tage Isolationshaft – und zur Frage, wer die Häftlinge in der Haftanstalt El Pavón erschossen hat.
Erhaben steht der Palais de Justice im warmen Licht der Herbstsonne, von der Promenade de Saint-Antoine her dringt ab und an das ausgelassene Geschrei spielender Kinder und Hundegebell herüber, in den Strassencafés der Cité herrscht lässige Geselligkeit, in der Ferne sticht der Jet d’eau in den Himmel. Wenn Erwin Sperisen aus dem Fenster seiner Altstadtwohnung blickt, präsentiert sich Genf von einer lieblichen, fast kitschigen Seite.
Die Welt hinter der Fassade ist etwas weniger beschaulich. Erwin Sperisen teilt sich mit seiner Frau Elisabeth ein kleines Schlafzimmer, die drei Kinder schlafen in der Wohnküche. Mehr erlaubt das Genfer Sozialamt der Familie nicht, die man eigentlich schon lange loswerden wollte. Doch Erwin Sperisen kann nicht wegziehen. Eine elektronische Fussfessel hindert ihn daran. Und er will auch nicht. Denn der 48-Jährige kämpft für seine Rehabilitation. Eine Frage von Ehre und Prinzipien.
Der Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa glaubte ein leichtes Spiel zu haben, als er den ehemaligen Polizeichef von Guatemala am 31. August 2012 verhaften liess. Ein Kronzeuge und Dokumente aus Zentralamerika sollten beweisen, dass Erwin Sperisen 2006 in seiner Heimat bei einer Razzia im Megagefängnis El Pavón sieben Häftlinge umgebracht habe. Da man den Schweizer Doppelbürger nicht nach Guatemala ausliefern konnte, machte ihm Bertossa in Genf den Prozess.
Doch der Sperisen-Prozess entpuppte sich bald als juristischer Albtraum. Die von politischen Machenschaften kontaminierten Aussagen aus Guatemala waren das Papier nicht wert, auf dem sie protokolliert worden waren, sie strotzten nur so vor Widersprüchen. Die mit Privilegien und Straferlass gekauften Kronzeugen, die man mit viel Aufwand aus Guatemala einfliegen liess, halfen nicht weiter: lauter Spekulationen, wenig Konkretes, nichts Überprüfbares.
Während in Guatemala, Österreich und Spanien ein Mitangeschuldigter nach dem andern freigesprochen wurde, hielt die Genfer Justiz stur an der Anklage gegen Sperisen fest. Die Vorwürfe wurden dauernd abgeändert. Mal soll Sperisen Häftlinge eigenhändig exekutiert haben, dann soll er sich absichtlich vom Tatort ferngehalten haben. Und je länger der Prozess dauerte, desto schwieriger wurde es für die Genfer Justiz, einzugestehen, dass sie den Falschen eingekerkert hatte.
Ende September 2017 setzte das Bundesgericht dem Trauerspiel ein Ende und verfügte die sofortige Freilassung von Erwin Sperisen. Seither befindet er sich in Hausarrest, keine hundert Meter vom Genfer Justizpalast entfernt. Die Bedingungen sind schikanös. Dreimal pro Woche muss Sperisen auf einem Polizeiposten am anderen Ende der Stadt Präsenz markieren. Die Genfer Justiz hat es auch nicht eilig, der neue Prozess ist auf nächsten Frühling anberaumt. Doch wenigstens ist Erwin Sperisen wieder bei seiner Familie. Er empfängt die Weltwoche in seiner kleinen Wohnung.
Herr Sperisen, gemäss Bundesgericht gibt es keine Zweifel, dass vor elf Jahren bei der Stürmung des Gefängnisses El Pavón Häftlinge exekutiert wurden – aber es ist nicht bewiesen, dass Sie verantwortlich sind. Wer hat die sieben Häftlinge getötet?
Ich habe mir diese Frage immer wieder gestellt. Es war ein Grosseinsatz mit 2500 Einsatzkräften aus Armee, Polizei, Sondereinheiten, Gefängnispersonal. Ich war auf der anderen Seite des Gefängnisses El Pavón, 300 Meter vom Ort entfernt, als es eine Schiesserei zwischen Häftlingen und Ordnungskräften gab. Videoaufzeichnungen belegen, dass Schüsse aus dem Gefängnis heraus abgefeuert wurden. Es war nicht meine Aufgabe, diese Todesfälle zu untersuchen. Die Staatsanwaltschaft war bei der Razzia von Anfang an dabei. Aufgrund der Obduktionsberichte müssen wir heute leider davon ausgehen, dass es Exekutionen gab, zumindest in drei Fällen. Damals hatte ich aber keine Einsicht in die Untersuchungen, das war allein Sache der Staatsanwaltschaft.
Jemand muss diese Exekutionen angeordnet und ausgeführt haben. Was denken Sie?
Ich weiss es wirklich nicht. Ich kann nur sagen: Eine von oben angeordnete Strategie, wie es der Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa behauptet, gab es nie. Alle Verdächtigten – unser Vorgesetzter, Innenminister Carlos Vielmann, mein Kollege, Vollzugschef Alejandro Giammattei, meine Untergebenen, die Einsatzleiter Javier Figueroa und Mario García Frech –, alle wurden sie freigesprochen. Es gibt allerdings eine zentrale Figur in dieser Geschichte, die nie angeklagt wurde: Luis Linares Pérez. Der Kronzeuge der Anklage.
Erklären Sie das bitte?
Linares Pérez war vom Nachrichtendienst der Armee, deren Rolle leider nie untersucht wurde. Er war mit den Vorbereitungen der Razzia betraut, er war in die Schiesserei involviert. Wenige Tage vor der Razzia gab es einen Konflikt zwischen inhaftierten Drogenhändlern und alten Armeekollegen von Linares Pérez. Die Aussagen von Pérez – die mich im Übrigen nicht einmal direkt belasten – strotzen nur so vor Widersprüchen. Er hat diese immer wieder geändert und angepasst. Ich vermute, dass er sich vor allem selber entlasten wollte, indem er andere anschwärzte. Zur Belohnung bekam er Straffreiheit und ein Aufenthaltsvisum für Kanada.
Im Vorfeld der Gefängnisrazzia gab es Drohungen der Mafia gegen Vollzugschef Alejandro Giammattei. Es wäre logisch, vielleicht sogar verständlich, wenn die Regierung in dieser Situation gesagt hätte: «Bevor sie uns umbringen, bringen wir die Mafiaführer um.»
Diese Hypothese wurde gegen Giammattei postuliert, aber er wurde freigesprochen. dem war nicht so. Und wenn es so gewesen wäre – dann wäre es das Problem der Strafvollzugsbehörden gewesen, nicht meines. Ich hätte damit nichts gewonnen, aber sehr viel riskiert. Ich wurde ja nicht bedroht.
Ihre politischen Gegner werfen Ihnen vor, systematisch «soziale Säuberungen» betrieben zu haben. Wollten Sie das Verbrechen mit Verbrechen bekämpfen?
Seit der conquista gab es in Guatemala immer wieder diese Gräuel, eigentlich schon zuvor. Ich war angetreten, um die Gewalt zu bekämpfen. Ich wurde in den 1990er Jahren politisiert. Das war die Zeit der Friedensverhandlungen von Esquipulas. Ich gehöre einer politischen Generation an, die mit der Hoffnung und dem Willen angetreten ist, den Terror zu überwinden und Guatemala zu einer modernen, zivilisierten Nation zu machen. Die grössten Probleme hatte ich im Polizeikorps selber, weil ich keine Korruption und keine Lynchjustiz akzeptierte.
Wo stehen Sie politisch?
Ich bin eher konservativ, Mitte-rechts. Extreme sind mir fremd. Ich glaube, die Dinge müssen organisch wachsen. Ich glaube an die traditionellen christlichen Werte. In wirtschaftlichen Fragen halte ich mich eher an Hayek als an Keynes.
Die Genfer Linke beschreibt Sie als Oligarchen. Wie sehen Sie das?
Meine Grosseltern hatten eine kleine Glaserei in Guatemala-Stadt. Sie haben in den 1960er Jahren alles verloren. Mein Vater hat aus eigener Kraft eine Schreinerei aufgebaut, aus der schliesslich eine kleine Möbelfabrik wurde. Über den Verband der Kleinunternehmer kam er zur Politik und schliesslich zu seinem Mandat in Genf, wo er Guatemala bei der WTO vertritt.
Wie steht es mit Ihrer Beziehung zur Schweiz?
Anders als mein Vater lernte ich keine der Landessprachen. Ich reiste trotzdem mit zwanzig Jahren in die Schweiz, um mich für die Rekrutenschule zu stellen, wie es schon mein Vater getan hatte. Doch man wollte mich nicht; zum einen lag es an fehlenden Sprachkenntnissen, zudem weckte meine Begeisterung fürs Militär Misstrauen. Ich weiss, das kann man jetzt gegen mich auslegen. Aber ich bin kein Rambo. In der Schweizer Armee wollen sie nur Soldaten, die eigentlich keinen Dienst leisten möchten. (Lacht)
Ihre Ausbildung?
Ich studierte Betriebswirtschaft in Guatemala und machte ein Praktikum in einem Hotel. Mein Chef begeisterte mich für die Politik und holte mich in die Stadtverwaltung von Guatemala. Als Werkstudent machte ich mein Lizenziat in Politologie. An der Universität lernte ich meine Frau Elisabeth kennen, eine Salvadorianerin mit Schweizer Wurzeln.
Wie wurden Sie zum politischen Chef der Policía Nacional Civil von Guatemala?
Schon als Teenager engagierte ich mich bei der Freiwilligenfeuerwehr. Ich weiss, es tönt kitschig, gerade in meiner Rolle als angeblicher Massenmörder. Aber es ist so: Ich fühlte mich immer berufen, etwas für das Gemeinwohl zu tun. 2004 bekam ich das Angebot als Feuerwehrkommandant. Ich war bereits in Lohnverhandlungen, als mir Innenminister Carlos Vielmann überraschend die Funktion des Polizeichefs anbot. Die Position schien mir ein paar Nummern zu gross. Meine Freunde und meine Familie beknieten mich, die Stelle auszuschlagen. Die Polizei hat einen miserablen Ruf in Guatemala, sie gilt als politischer Friedhof. Bei der Feuerwehr kann man nicht viel falsch machen. Aber ich sagte mir schliesslich: Man kann nicht immer die Polizei kritisieren und sich dann verstecken, wenn man die Chance bekommt, etwas zu tun.
Wie viel verdienten Sie als Polizeichef?
2800 Dollar im Monat. Meine Frau verdiente als Wirtschaftsberaterin besser. (Lacht)
Was waren die wichtigsten Anliegen als Polizeichef?
Es fehlte an allem. In einer ersten Auslegeordnung definierten wir über 500 Projekte, von denen ich in drei Jahren etwa die Hälfte einleiten und einige davon auch erfolgreich abschliessen konnte. Neben der Infrastruktur war die Korruption das grösste Problem. Wir haben Lebensversicherungen für die Witwen ermordeter Polizisten eingeführt, Kinderhorte, eine medizinische Versorgung für Angehörige, wir bauten sichere Wohnsiedlungen, wir verbesserten Ausbildung und Karrieremöglichkeiten. Es ging darum, die Polizisten enger an die Institution zu binden, sie zu beschützen. Das ist das effizienteste Mittel gegen die Korruption. Dazu kam die internationale Koordination. Ich war sehr aktiv als Präsident der Organisation der Polizeichefs von Zentralamerika und der Karibik sowie bei Interpol.
Noch während Ihrer Amtszeit wurde die internationale Untersuchungskommission Cicig* einberufen, die Sie später anklagen sollte. Welches war das Ziel?
Ursprünglich ging es darum, eine Untersuchungsbehörde zu schaffen, welche mafiöse Parallelstrukturen innerhalb der staatlichen Organismen aufdecken und bekämpfen sollte. Ich habe das voll unterstützt. Als 2008 die neue Regierung unter Álvaro Colom an die Macht kam, schlug die Cicig aber eine andere Richtung ein.
Warum?
Offensichtlich kam die Cicig bei der Bekämpfung der Mafia innerhalb des Staates nicht weiter. Man musste Erfolge vorweisen, also nahm man das, was am einfachsten erschien. Die neue Regierung unter Álvaro Colom gab der Cicig daher den Auftrag, den Fall El Pavón zu untersuchen, der bereits ein Politikum war.
2006 zogen Sie mit der Familie nach Genf. Warum?
Es hatte Mordattentate auf mich gegeben sowie Drohungen gegen meine Frau und meine Kinder. Deshalb schickte ich die Familie nach Genf, wo mein Vater bei der WTO arbeitet. Geplant war nur ein einjähriger Aufenthalt. Doch dann fand meine Frau Arbeit bei der Uno, die Kinder gewöhnten sich ein. Dann kam der Skandal um die Ermordung von drei Parlamentariern durch Polizisten dazwischen. Eine komplizierte Geschichte, bei der Drogengeld mit im Spiel war. Wir konnten die Polizisten überführen. Mein Rücktritt war ein rein politischer Entscheid, mir wurde nie ein Verschulden zur Last gelegt. So reiste auch ich in die Schweiz, zu meiner Familie.
Weshalb gab es Anschläge gegen Sie?
Ich liess mich von keiner Mafiabande vereinnahmen.
Wie muss man sich das vorstellen?
Die Offerten kommen immer über untergeordnete Informanten. Die eine Mafiabande spielt der Polizei Informationen über eine Konkurrenzbande zu. Das gibt Fahndungserfolge, Prestige. Die US-amerikanische Drogenvollzugsbehörde DEA macht das so. Doch für den Polizisten, der mit seinen täglichen Geldnöten kämpft, ist die Versuchung gross, etwas für sich oder die Institution abzuzwacken. Ich habe das in Guatemala gestoppt. Wir arbeiteten mit keiner Bande mehr zusammen. Die grossen Fahndungserfolge gingen dadurch zwar zurück, doch keine der Banden konnte sich nunmehr auf den Schutz der Polizei verlassen. Da kamen die Morddrohungen, verbunden mit diskreten Offerten. Der Klassiker: «plata o plomo» – die Wahl zwischen Geld oder Blei.
Was waren Ihre Pläne in der Schweiz?
Ich hatte Aussichten auf eine Stelle bei Interpol in Lyon. Das ist nicht weit von Genf entfernt und hätte sehr gut gepasst. Als Polizeichef hatte ich die Beziehungen zu Interpol gefördert und modernisiert, ich hatte einen sehr guten Ruf in Lyon. Als die Anschuldigungen der Cicig gegen mich auftauchten, war das natürlich kein Thema mehr.
Wie erfuhren Sie von den Anschuldigungen gegen Ihre Person?
Das war im September 2010, aus den Nachrichten. Die Cicig kündigte eine Anklage gegen neunzehn Funktionäre der Regierung Berger an, darunter war auch mein Name. Sie beschuldigten uns wegen siebzehn Delikten, von Drogenhandel über sexuelle Belästigung bis zu Mord, ein bunter Strauss. Ich informierte den damaligen Genfer Generalstaatsanwalt Daniel Zappelli, teilte ihm mit, wo ich lebe und dass ich vorbehaltlos kooperiere. Zwei Wochen später wurde meine Frau bei der Uno entlassen, ohne Begründung.
Was geschah dann?
Ein Jahr lang passierte überhaupt nichts. 2011 bestellte mich Staatsanwalt Michel-Alexandre Graber auf sein Büro. Er zeigte mir einen Bericht der Cicig, der ihm aus Guatemala zugestellt worden war. Gegen mich lag gar nichts Konkretes vor. Ein Jahr später erfuhr ich, dass nun ein neuer Staatsanwalt den Fall übernommen habe, Yves Bertossa. Das alarmierte mich insofern, als Bertossa eng mit der NGO Trial liiert war, wie ich in einer Google-Recherche festgestellt hatte. Linke Gruppen, die mit Trial eng verbunden sind, machten schon seit längerem Stimmung gegen mich. Trial hatte sogar einen Privatdetektiv auf mich angesetzt.
Am 31. August 2012 liess Bertossa Sie verhaften. Wie haben Sie das erlebt?
Mit meiner Frau befand ich mich auf einem Parkplatz hier in Genf. Plötzlich waren wir von zwölf Männern umringt, die ihre Waffen auf uns richteten. Wir glaubten an einen Überfall. Es war eine Erleichterung, als ich merkte, dass es die Polizei war. Es war ein Theater, reine Stimmungsmache. Bertossa hätte mir eine Einladung schicken können.
Staatsanwalt Bertossa glaubte eben, den Beweis zu haben, dass Sie ein Massenmörder sind – der Zeuge Philippe Biret hatte sich bei ihm gemeldet. Der Franzose, der wegen eine Doppelmordes damals im El Pavón eine Strafe von 35 Jahren Haft verbüsste, behauptete, mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie Sie bei der Gefängnisrazzia Häftlinge erschossen hätten.
Die Organisation Trial hatte diesen Zeugen Biret ins Spiel gebracht. Was er erzählte, war einfach zu widerlegen. Biret behauptete, ich hätte einem der Opfer in den Kopf geschossen – doch in den Autopsien finden sich keine Kopfverletzungen. Alle Verletzungen stammten von Kugeln vom Kaliber 5.56 – das passt nicht zu einer Faustfeuerwaffe. Biret behauptete zudem, die Morde seien am späteren Nachmittag geschehen – doch die sieben Häftlinge waren am Morgen gestorben. Vor Gericht hiess es dann, die Widersprüche seien Folge eines erlittenen Traumas. Dass er gelogen haben könnte, wurde nicht einmal in Betracht gezogen.
Mittlerweile sind Birets Beschuldigungen kein Thema mehr, das Appellationsgericht hat diese verworfen. Warum hat Biret Sie falsch beschuldigt?
Ich habe über Dritte erfahren, dass sich Philippe Biret durch die Aussage gegen mich in Guatemala die vorzeitige Haftentlassung erkauft hatte. So lief es in diesem Verfahren von Anfang an bis zum Ende: Leute wurden belohnt oder unter Druck gesetzt, damit sie sagten, was man von ihnen hören wollte.
Anfang 2013 machte Bertossa Ihnen ein Angebot: Wenn Sie irgendein Nebendelikt gestehen und andere beschuldigen würden, würde er Sie in einem geheimen Schnellverfahren mit fünf Jahren Gefängnis laufenlassen. Warum haben Sie das nicht angenommen?
Weil ich nicht ein Verbrechen gestehe, das ich nicht begangen habe. Und weil ich keine falschen Anschuldigungen gegen andere mache.
Alle Anklagen, die in Guatemala von der Cicig gegen die politischen Vorgesetzten und die Chefs von Polizei und Strafvollzug erhoben wurden, führten später zu Freisprüchen – ausser in Ihrem Fall. Was war das Motiv für diese offenkundig haltlosen Anklagen?
Die Cicig-Ermittlerin Gisela Rivera, eine Juristin aus Costa Rica, stand unter grossem Druck, einen Erfolg zu liefern. 2009 musste sie Guatemala fluchtartig verlassen. Weil sie Zeugen unter Druck gesetzt und geheime Absprachen getroffen hatte, wurde sie international zur Verhaftung ausgeschrieben. Riveras Nachfolger waren leider nicht besser. Die Politik hatte immer die Finger im Spiel – die Grüne Partei Genfs, die Grünen in Österreich, die Sozialisten in Guatemala, dazwischen Trial.
Bertossa wusste das?
Natürlich. Er war ja Teil des Theaters. Bertossa ist mit Trial verbandelt, Cicig-Ankläger Carlos Castresana war Parlamentarier der Vereinigten Linken (Izquierda Unida) in Spanien. Im Parallelprozess gegen meinen Stellvertreter Javier Figueroa in Österreich verwahrte sich die Gerichtspräsidentin dezidiert gegen die politische Einmischung. Das war in Genf leider nicht der Fall. Figueroa wurde freigesprochen. Es war ein politischer Prozess, von A bis Z.
Wie erlebten Sie die Prozesse in Genf?
Mir war schnell klar, dass ich keine Chance hatte. Man merkte es an der Haltung der Staatsanwälte und Richter. Mit Gesten und abfälligen Bemerkungen gaben sie mir zu verstehen, dass meine Aussagen sie nicht interessierten, dass sie mir ohnehin kein Wort glaubten, dass das Urteil längst gefällt sei und dass sie nur noch nach Elementen suchten, um dieses irgendwie zu begründen.
Im ersten Genfer Prozess wurden Sie verurteilt, weil Sie sich aktiv am Massaker beteiligt hätten, im zweiten, weil Sie sich so passiv verhalten hätten. Wie erklären Sie diese Wende?
Das ist ein Muster, das sich durchs ganze Verfahren zieht. Die Verteidigung widerlegte eine Anschuldigung nach der andern – weil die Aussagen widersprüchlich waren, weil sie nicht zu den Fakten passten. Doch mit jeder Version, die wegfiel, tauchte eine neue auf, die Anschuldigungen wurden permanent angepasst. Es war wie in einem Albtraum, der nie ein Ende nehmen will. Nur war der Albtraum real. Am Schluss hat man die angeblichen Mitverschwörer, die im Ausland längt freigesprochen worden waren, einfach mit verurteilt – ohne formelle Anklage, ohne dass sie sich hätten verteidigen können. Was wollen Sie da noch sagen?
Wie fühlt man sich in einem solchen Prozess?
Ohnmächtig, einfach nur ohnmächtig. Man machte mir von Anfang an klar: Hier bist du allein – als Karikatur des Polizeichefs einer Bananenrepublik, dem keiner glaubt – gegen Staatsanwälte, Regierungen, die NGOs, die Uno, die Welt. Jedes Wort, das man sagt, wird verdreht und gegen einen ausgelegt. Es war zum Verrücktwerden.
Was denken Sie: Was ging in Bertossas Kopf vor?
Ich glaube, er hat mich gar nicht als Mensch wahrgenommen, sondern als abstrakte Figur. Eine Sprosse in seiner Karriereleiter.
Aber warum? Die meisten Genfer wissen kaum, wo Guatemala liegt. Warum soll Ihre Verurteilung so wichtig sein für einen Staatsanwalt in Genf?
In Genf möchte man so etwas wie eine globale Staatsanwaltschaft für Menschenrechte einrichten. Die Cicig in Guatemala war ein Pilotprojekt für die globale Strafverfolgung in sogenannten failed states. Es gibt in Genf sehr einflussreiche und aktive NGOs wie Trial.
Im Namen der Menschenrechte sassen Sie fünf Jahre in Untersuchungshaft – isoliert in einer Einzelzelle. Wie muss man sich das vorstellen?
Eine derart lange Isolationshaft wird verfügt, um einen Menschen zu brechen – moralisch, physisch, mental. 23 Stunden pro Tag ist man eingesperrt in einer Zelle, 2,35 Meter breit und 4,5 Meter lang, eine Toilette, eine Pritsche. Man zählt die Tage (Sperisen holte ein Heft hervor), hier, man macht für jeden Tag ein Kreuz – 1849 Tage, 272 Wochen, 60 Monate. Einmal pro Tag sich die Beine vertreten, allein, für eine Stunde in einem Käfig auf dem Dach. Ein-, manchmal zweimal pro Woche eine Stunde Familienbesuch. Meine Frau kam 423 Mal, manchmal mit den Kindern. Ich habe meine Kinder in den fünf Jahren gut eine Woche lang gesehen, immer unter Bewachung. Um sieben Uhr in der Früh schauen die Wärter kurz rein, um zu sehen, ob man noch lebt, sie sprechen ein paar Sätze, um zu sehen, ob man noch bei Sinnen ist. Um sieben, um elf und um siebzehn Uhr schieben sie das Essen rein, um 18 Uhr 15 verabschiedet sich das Personal.
Hatten Sie Angst, verrückt zu werden?
Permanent. Man muss ständig etwas tun. Es braucht viel Disziplin, um nicht verrückt zu werden. Im Schnitt hatte ich pro Woche drei Stunden direkten Kontakt mit Menschen.
Baut sich da nicht Hass auf – auf Staatsanwalt Bertossa, die Richter?
Hass und Verachtung. Aber ich habe diese Gefühle bewusst nicht zugelassen. Mit dem Hass hätte ich mir selber am meisten geschadet. Ihnen ist das egal. Würde ich diese Leute hassen, wäre mein Leben mit dem ihren verbunden.
Was ist schlimmer – fünf Jahre in einem guatemaltekischen Knast wie El Pavón, wo sich die Häftlinge frei bewegen, oder fünf Jahre Isolation in einem Schweizer Gefängnis?
Das kommt drauf an. Ein Gangsterboss hat in El Pavón alles, was man sich erdenken kann. Aber wer kein Geld hat, lebt wie ein Sklave, bar jeglicher Menschenwürde, ohne Schutz und ohne Gesetz. Das war ja der Zustand, den wir mit der Razzia beenden wollten. Hier in der Schweiz ist es das andere Extrem. Alles ist reglementiert und überkontrolliert – auch das führt zu einer Entmenschlichung.
Wie fühlten Sie sich, als Sie nach fünf Jahren aus der Zelle kamen?
Es war ein Schock. Ich fühlte mich wie ein Behinderter, dem man die Krücken weggenommen hat, wie ein Emigrant, der nach langer Zeit in seine Heimat zurückkehrt – man kennt alles, und doch ist alles fremd. In der Nacht stand ich manchmal auf, ging zu den schlafenden Kindern hinüber, um mich zu vergewissern, dass sie noch da waren.
Warum behandelt die Schweiz ihre eigenen Staatsangehörigen so schlecht?
Ich weiss es nicht. Die Schweiz ist ein sehr geordnetes, in mancher Hinsicht vorbildliches Land. Man will alles perfekt machen, ist mit den eigenen Leuten strenger als mit Fremden. Mein Grossvater zog von der Schweiz weg, weil er mehr wollte, als ihm dieses Land bieten konnte. Vielleicht hat man ihm das übelgenommen. Es ist, als würde die Herde das Schaf ausstossen, das es gewagt hat, die Herde zu verlassen.
In Guatemala scheint Ihr Ruf kaum beschädigt, im Gegenteil, für viele sind Sie ein Held. Auf Facebook haben Sie 30 000 Follower, die Kommentare sprechen alle für Sie.
32 000 Follower! Mein Bruder hat die Seite eingerichtet, ich habe das kaum mitbekommen und war überwältigt von der Unterstützung in Guatemala. Eine halbe Million User haben meine Videobotschaft gesehen, die mein Bruder nach meiner Freilassung gepostet hat.
Werden Sie nach Guatemala zurückkehren, wenn das alles einmal vorbei ist?
Ich weiss es nicht. Ich fühle mich als Guatemalteke. Aber meine Familie hat sich in Genf eingelebt, meine Kinder werden kaum wegziehen wollen.
(Copyright Weltwoche, Ausgabe-Nr. 51/52-2017, Seite 88)
11. Rette sich, wer kann
29. März 2018 - drei Wochen vor der Neuauflage des Sperisen-Prozesses in Genf werden zwei weitere Richter ersetzt. Die offizielle Begründung ist fadenscheinig. Der Gerichtsfall wird zum Politikum. Von Alex Baur
Alessandra Cambi Favre-Bulle, Vizepräsidentin des Genfer Kriminalgerichtes, hat schwierige Tage vor sich. Aufgrund vager Indizien und Kronzeugen-Aussagen hatte das Gericht unter ihrer Regie den ehemaligen politischen Chef der Nationalpolizei von Guatemala im Juli 2015 wegen angeblicher Gefangenen-Exekutionen zu «lebenslänglich» verurteilt. Als das Bundesgericht das Urteil im letzten Juli wegen Willkür und anderer fundamentaler Mängel annullierte, schaltete Cambi Favre-Bulle auf stur. Gegen ihren erbitterten Widerstand musste Sperisen nach fünf Jahren Untersuchungshaft beim Bundesgericht seine Freilassung erzwingen («Bertossas Rückzugsgefecht», Weltwoche Nr. 39/17).
Cambi Favre-Bulle wird wohl oder übel auch über sich selber zu Gerichte sitzen, wenn am 15. April der Fall Sperisen vor dem Genfer Kriminalgericht neu aufgerollt wird. Doch mittlerweile steht die FDP-Richterin ziemlich alleine da. Fünf der sieben mitverantwortlichen Richter haben sich inzwischen diskret aus dem Fall verabschiedet, der sich längst zum juristischen Albtraum ausgewachsen hat.
Vor allem der Abgang der Nebenrichter Monika Sommer und Roland-Daniel Schneebeli lässt tief blicken. Cambi Favre-Bulle avisierte deren Rücktritt mit Schreiben vom 21. März, also gerade mal drei Wochen vor Prozessbeginn. Begründung: Die beiden Laienrichter bewerben sich für die FDP um einen Sitz im Kantonsparlament, doch die Gewaltentrennung verbiete ein solches Doppelmandat. Die Wahl findet just einen Tag vor der Prozesseröffnung statt.
Die Begründung ist mehr als fadenscheinig. Die Vereidigung der neuen Grossräte findet – so Sommer und Schneebeli gewählt werden – erst am 15. Mai statt. So lange wird der Prozess kaum dauern. Dabei ist der Prozesstermin wie auch die Kandidatur der beiden seit einem halben Jahr bekannt. Wie die neuen Richter in drei Wochen den rund fünfzig Bundesordner dicken Aktenberg bewältigen sollen, ist ein Rätsel. Zur Erinnerung: Das Bundesgericht brauchte dafür zwei Jahre.
Juristischer Albtraum
Die wirklichen Motive der richterlichen Rochade sind so undurchsichtig wie das ganze Verfahren, das von Anfang an politisch verseucht war. Klar ist lediglich: Lorbeeren sind hier keine mehr zu holen. Mit dem Urteil des Bundesgerichtes hat der Wind gedreht. Im Grossen Rat geht das Gespenst einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) um. «Nur schon die Forderung nach einer PUK hatte die Wirkung eines Donnerschlages auf das Dossier», sagt Sperisen-Verteidiger Florian Baier.
Als der Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa im August 2012 in enger Zusammenarbeit mit der NGO Trial das Sperisen-Verfahren mit einem grossartigen Verhaftungsspektakel eröffnete, wollte er der Welt zeigen, wie man in Guatemala Recht und Ordnung schafft. Dass die vagen, oft abenteuerlichen bis widersprüchlichen Aussagen der gekauften Kronzeugen das Papier nicht wert waren, auf dem sie protokolliert wurden, musste er bald erkannt haben. Doch je länger Sperisen in Haft sass, desto grösser der Erfolgsdruck, desto mehr zauberte Bertossa. Und keiner stoppte ihn.
Sämtliche vermeintlichen Mitverschwörer, die mit Erwin Sperisen auf Regierungsebene «soziale Säuberungen» geplant haben sollen, wurden in Guatemala, Spanien und Österreich freigesprochen. Am Ende blieb nur noch Sperisen. Da sich der Polizeichef nicht mit sich selber verschworen haben konnte, verurteilte das Genfer Kriminalgericht die drei Freigesprochenen kurzerhand mit ihm – in Abwesenheit, ohne Anhörung, ohne Verteidigung. Man braucht kein Jurist zu sein, um zu begreifen, dass so etwas nicht geht. Und das war nur einer von vielen Mängeln, die das Bundesgericht rügte.
Seit 2014 kritisiert Grossrat Thierry Cerutti (Mouvement citoyens genevois MCG), selber ein Polizeioffizier, die politisch motivierte Vorverurteilung Sperisens und die «république bananière de Genève». Wegen Richterbeleidigung wurde er im Polizeikorps kürzlich zurückgestuft. Doch Cerutti liess sich vom Zähmungsversuch nicht beeindrucken. In einer dringenden Anfrage verlangte er kürzlich eine Zusammenstellung der Kosten des Monsterverfahrens. Besonders brisant ist in diesem Zusammenhang der Betrag von angeblich rund 100 000 Franken, den allein die Privatkläger abkassiert haben sollen.
Die Anwälte Alexandra Lopez und Alec Reymond treten als Nebenkläger im Namen der Mutter eines der in Guatemala getöteten Häftlinge auf. Wie die Zeitschrift L’Illustré bereits 2014 aufdeckte, fiel die Frau aus allen Wolken, als sie vom Prozess in Genf erfuhr. Sie sagte dem Reporter vor laufender Kamera, sie kenne die Anwälte nicht. Sie habe nichts gegen Erwin Sperisen, verantwortlich für den Tod ihres Sohnes sei der damalige Vollzugschef. Konsequenzen hatte die Enthüllung keine.
In einem Schreiben an die Genfer Anwaltskammer (Commission du barreau) forderte Sperisen, dass dieser schwerwiegende Vorwurf wenigstens untersucht werde, wie die Genfer Zeitung GHI kürzlich berichtete. Viel darf er von diesem Schritt allerdings nicht erwarten: Richterin Alessandra Cambi Favre-Bulle und Anwalt Alec Reymond wirken beide als Vizepräsidenten im dreiköpfigen Büro der Anwaltskammer. Materiell mag es ein Nebenschauplatz sein. Doch die Episode zeigt, wie eng die persönlichen und politischen Verbandelungen im Genfer Justizkabinett sind.
(Copyright Weltwoche, Ausgabe-Nr. 13/2018, Seite 41)
12. Was die Genfer Justiz nicht hören will
12. April 2018 - Der ehemalige Staatspräsident von Guatemala ist nach Genf gereist, um im Fall Sperisen persönlich auszusagen. Doch Staatsanwalt und Richter weigern sich, Oscar Berger auch nur anzuhören. Denn er hat einiges zu sagen, was Ex-Polizeichef Erwin Sperisen entlastet.
Oscar Berger wurde 2004 zum Staatspräsidenten von Guatemala gewählt, er regierte das zentralamerikanische Land bis 2008. Unter seiner Regierung wurden 2006 während einer Razzia im Gefängnis El Pavón sieben Häftlinge getötet. Nächste Woche fängt in Genf der neue Prozess gegen den damaligen Polizeichef Erwin Sperisen an, der für diese Morde verantwortlich sein soll.
Berger ist mittlerweile 72 Jahre alt und lebt zurückgezogen auf seiner Finca. Am politischen Leben nimmt er kaum noch teil. Trotzdem ist er extra nach Genf gereist, um als Zeuge im Sperisen-Prozess auszusagen. Immerhin war Sperisen Mitglied seiner Regierung, die das angebliche Gefängnismassaker angeordnet haben soll. Doch die Genfer Justiz will Berger nicht anhören. Denn was er sagt, steht einer Verurteilung im Weg. Die Weltwoche traf ihn zu einem Gespräch in Genf.
Herr Berger, Sie selber haben die internationale Untersuchungskommission Cicig nach Guatemala geholt, welche unter Ihrem Nachfolger Alvaro Colom die Mordanklage gegen mehrere Mitglieder Ihrer Regierung erhob, so auch gegen Polizeichef Erwin Sperisen. Was war die Idee?
Wir sahen, dass es in Guatemala grosse Defizite vor allem bei der Bekämpfung der Korruption innerhalb des Staates gab, die wir selber nicht lösen konnten. Leider kam auch die Cicig nicht weiter. Um endlich einen Erfolg vorweisen zu können, verlegten sich die Ermittler auf die Razzia im Gefängnis El Pavón, in die meine Regierung involviert war und die ein internationales Echo versprach. Doch alle Prozesse gegen die Beschuldigten – Innenminister Carlos Vielman in Spanien, Polizeikommandant Javier Figueroa in Österreich, Vollzugschef Alejandro Giammattei und weitere Verdächtigte in Guatemala –, alle endeten mit einem Freispruch. Die Prozesse zeigten zudem auf, dass die Cicig mit höchst fragwürdigen Methoden eine Anklage fabriziert hatte. Es bleibt nur noch der Prozess in Genf gegen Erwin.
Als Staatspräsident trugen Sie eine Mitverantwortung. Wurden Sie ins Recht gefasst?
Man hat es zumindest versucht. Die Razzia wurde monatelang geplant, unter meiner Führung. Das Gefängnis El Pavón war ein Zentrum des organisierten Verbrechens, das längst jeder Kontrolle entglitten war. Einzelne Häftlinge waren bewaffnet. Alle möglichen Instanzen waren involviert, neben Polizei und Militär namentlich die Staatsanwaltschaft und Menschenrechtsorganisationen. Die Razzia selber wurde von zahlreichen Journalisten beobachtet und als ein Erfolg gelobt. Im Figueroa-Prozess in Österreich wurde ich als Auskunftsperson befragt. Ein Kronzeuge hatte behauptet, er hätte gesehen, wie ich an einer Sitzung teilgenommen hätte, an welcher der Mordplan beschlossen worden sei. Ich zeigte vor Gericht meinen alten Pass und konnte dank den Migrationsstempeln beweisen, dass ich zur fraglichen Zeit gar nicht in Guatemala weilte, weil ich nämlich vor der Uno in New York eine Rede hielt. Der einzige Kronzeuge, der eine konkrete Aussage gemacht hatte, war damit als Lügner entlarvt. Doch in Genf wollte man davon nichts wissen. Ich wurde nicht als Zeuge zugelassen.
Wären Sie nach wie vor bereit, auszusagen?
Aber sicher. Doch in Genf wollten weder Staatsanwälte noch die Richter hören, was gegen eine Verurteilung spricht. Insgesamt achtzehn Zeugen der Verteidigung, so wurde mir gesagt, wurden nicht angehört. Ich könnte einiges zur Person von Erwin sagen. Das war nicht erwünscht. Stattdessen baute man blind auf die widersprüchlichen Aussagen von Schwerverbrechern und Mitbeschuldigten, die mit Haftverschonungen und Zeugenschutzprogrammen gekauft worden waren.
Dann lassen Sie uns wissen, was die Genfer Justiz nicht hören will.
Ich kenne Erwin seit seiner Kindheit. Er ist nicht der, als der er hingestellt wurde. Wir haben Erwin in die Regierung geholt, weil wir wussten, dass er eine grundehrliche Haut ist. Als Aussenseiter war er nicht in die korrupten Netzwerke bei der Polizei verwickelt, die wir bekämpfen wollten. 2000 Polizisten, die nachweislich gegen das Gesetz verstossen hatten, wurden während seiner dreijährigen Amtszeit aus dem Korps entfernt. Die Modernisierung und die Reformen bei der Polizei waren vielleicht die erfolgreichste und auch allgemein anerkannte Errungenschaft meiner Regierung. Gewiss, es wäre noch viel zu tun gewesen, doch die Resultate waren ermutigend.
Das schliesst «soziale Säuberungen» nicht aus, die Sperisen vorgeworfen werden.
Das war nie unsere Politik. Wir wussten, dass einige Häftlinge in El Pavón bewaffnet waren, das war durch Videoaufzeichnungen belegt, die ich selber gesehen habe. Wir rechneten bei der Razzia mit Toten und Verletzten. Gerade deshalb wollten wir den Beauftragten für Menschenrechte von Anfang an beratend in die Planung einbinden. Er sagte weder ja noch nein, stahl sich aus der Verantwortung. Er wusste, dass es heikel werden würde.
Es fällt aber auf, dass bei der Gefängnisrazzia just die Spitze der Knasthierarchie eliminiert wurde. Spuren weisen darauf hin, dass zumindest einzelne Häftlinge erschossen wurden, nachdem sie sich ergeben hatten. Diese Männer werden sich kaum selber umgebracht haben. Was sagen Sie dazu?
Die Spuren sind alles andere als eindeutig, die Aussagen voller Widersprüche. Für mich ist es sehr schwierig, mir ein Bild zu machen. Über 2500 Einsatzkräfte aller Gattungen waren an der Razzia beteiligt. Es wäre vorstellbar, dass kriminelle Banden den Tumult für interne Abrechnungen nutzten. Die Sitten im Gefängnis waren brutal, Motive gab es viele. Ich weiss es nicht. Ich kann nur wiederholen: Eine Politik der «sozialen Säuberung» gab es nicht. Abgesehen davon würde man so etwas auch nicht unter den Augen Dutzender Journalisten machen, die das Geschehen verfolgten. In einem Rechtsstaat kann man nicht einfach aufgrund vager Verdächtigungen den Nächstbesten einsperren.
In der Schweiz sass Erwin Sperisen fünf Jahre lang ohne rechtskräftiges Urteil total isoliert in Untersuchungshaft, länger als alle andern – selbst als diese alle freigesprochen waren. Was sagen Sie dazu?
Es erschüttert mich, dass ausgerechnet in Genf ein derart einseitiger und willkürlicher Prozess geführt wurde. Es ist abscheulich, einen Schuldigen ungestraft laufen zu lassen, doch einen Unschuldigen einzusperren, ist monströs. Ich hielt die Schweiz immer für ein bewundernswert geordnetes Land, und das ist sie wohl auch. Doch der Glaube, dass man aus der Ferne eine derart komplizierte Geschichte in einem derart komplizierten Land wie Guatemala lösen könnte, war vermessen. Ich respektiere die Unabhängigkeit der Justiz, aber ich hoffe, dass die Richter noch einmal in sich gehen. Es lag sicher auch an den NGOs und linken Gruppierungen, die unsere Regierung politisch bekämpften und den «Fall Pavón» zum Fanal machen wollten. Die Untersuchung war von Anfang an verpolitisiert.
Für Guatemala ist das nichts Aussergewöhnliches. Neben Vinicio Cerezo sind Sie der einzige Präsident der letzten dreissig Jahre, der nach Ende der Amtsdauer nicht persönlich in Strafverfahren verwickelt war oder gar verhaftet wurde. In ganz Lateinamerika ist die Strafjustiz so etwas wie die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Man weiss nie, was politisch und was sachlich begründet ist, zumal die Justiz nicht weniger korrupt ist als die Politik. Die politisierte Justiz wurde damit zur Bedrohung für den Rechtsstaat, den sie eigentlich beschützen sollte.
Der Kampf gegen die Korruption ist ein grosses und wichtiges Thema. Die Menschen sind es einfach satt, von Leuten regiert zu werden, die, unbeeindruckt von der allgegenwärtigen Not, skrupellos in ihre eigene Tasche wirtschaften. Die Wut ist gross. In Guatemala begann dieser «lateinamerikanische Frühling», und ich glaube nicht, dass er wie der Arabische Frühling scheitern wird. Guatemala ist eine sehr junge Demokratie, die eigentlich erst 1986 mit Vinicio Cerezo begann. Es gab zwar schon früher Wahlen, doch sie waren stets mit eklatanten Mängeln behaftet. Die Institutionalisierung braucht ihre Zeit, es ist ein dorniger Weg, aber ich bin zuversichtlich.
Letztendlich trägt die Cicig die Verantwortung für das Polit-Justiz-Debakel im Fall El Pavón. Bereuen Sie nicht, diese Institution einberufen zu haben?
Nein. Es gab Irrungen in den Anfängen, aber es wurden auch Lehren daraus gezogen. Die Korruption ist ein reales Übel, das mit allen Mitteln bekämpft werden muss. Heute konzentriert sich die Cicig auf diese Aufgabe. Es gibt sicher immer noch juristische Exzesse und politische Vereinnahmungen, die korrigiert werden müssen, aber deshalb sollten wir nicht gleich das ganze System über Bord werfen.
(Copyright Weltwoche Ausgabe-Nr. 15/2018, Seite 40)
13. Irgendwie, irgendwer, irgendwo
19. April 2018 - Kurz vor der Neuauflage des Prozesses gegen Erwin Sperisen in Genf wollte Staatsanwalt Yves Bertossa seine Anklage ändern. Das Manöver ist symptomatisch für ein Verfahren, bei dem nie klar war, was dem Angeklagten konkret vorgeworfen wird. Diesmal scheiterte Bertossa. Eine Zwischenbilanz. Von Alex Baur
Zwölf Jahre sind ins Land gegangen, seit im fernen Guatemala bei einer Grossrazzia im Gefängnis El Pavón sieben Häftlinge erschossen wurden. Bald sechs Jahre sind vergangen, seit der damalige politische Chef der Policía Nacional Civil von Guatemala in Genf deshalb verhaftet wurde. Vor über vier Jahren erhob Staatsanwalt Yves Bertossa eine Anklage wegen zehnfachen Mordes. Schon vor dem Massaker in El Pavón soll Sperisen im Zuge «sozialer Säuberungen» die Exekution dreier Gangster angeordnet haben, die aus dem Gefängnis El Infiernito ausgebrochen waren.
Mit dem Fall Sperisen wollte der Genfer Staatsanwalt Bertossa in enger Zusammenarbeit mit der NGO Trial ein Fanal setzen: Kein politisches Verbrechen, wo immer auf der Welt es begangen wurde, sollte ungesühnt bleiben. Fünf Jahre lang sah es so aus, als ob es gelingen könnte. Fünf lange Jahre sass Erwin Sperisen in Genf in Isolationshaft. Doch im letzten Sommer rügte das Bundesgericht zahlreiche Verfahrensmängel – Verletzung des Anklageprinzips, Willkür, Missachtung von Verteidigerrechten – und liess den Traum des Genfer Weltgerichtes platzen. Sperisen kam frei. Seither ist die Genfer Justiz darum bemüht, Trümmer aufzuräumen und den Schaden zu begrenzen.
Nicht mehr in Ketten und durch die Hintertür, sondern als freier Mann durch das Hauptportal betrat Erwin Sperisen am letzten Montag den altehrwürdigen Palais de Justice in der Genfer Altstadt. Die scharfe Tonlage der früheren Prozesse, die bisweilen an die heilige Inquisition gemahnte, ist einer doch merklichen Ernüchterung gewichen. Mit einem freundlichen Lächeln ermunterte die Gerichtspräsidentin den Angeklagten – neuerdings stehen ihm gleich zwei Übersetzer zur Seite, obwohl er inzwischen leidlich Französisch spricht –, seine Sicht der Dinge einzubringen.
Jäger wurden zu Gejagten
Doch jetzt, wo man ihm zuhören will, mag Erwin Sperisen nicht mehr reden. Fünf Jahre lang habe er jede Frage beantwortet, sagt er, dieselbe Geschichte in zahlreichen Einvernahmen immer und immer wieder erzählt. Er habe den Eindruck gehabt, dass jede seiner Aussagen in ihr Gegenteil verdreht wurde. Das Vertrauen sei ihm nach fünf Jahren in der Isolationszelle abhandengekommen. Man wird es ihm nicht verübeln können, zumal er ein Recht beansprucht, das jedem Angeklagten zusteht.
Die einstigen Jäger sind längst zu Gejagten geworden. Es sind die Verteidiger, die nun anklagen und eine Million Franken für die unschuldig erlittene Untersuchungshaft fordern, zuzüglich 300 000 Franken Schmerzensgeld für Sperisens Frau und die drei minderjährigen Kinder. Ihr Antrag, zwei operationelle Leiter des Polizeieinsatzes von El Pavón einzuvernehmen, wurde vom Gericht zwar, wie schon in früheren Verfahren, abgeschmettert. Doch allein die Tatsache, dass die Polizeioffiziere, die effektiv am Tatort waren, bislang nie befragt wurden, lässt tief blicken. Was nicht zum vermeintlichen Mordkomplott passte, blieb in den früheren Verfahren aussen vor.
Abgeschmettert hat das Gericht indes auch den wenige Tage vor der Neuverhandlung eingereichten Antrag von Staatsanwalt Yves Bertossa, seine Anklage abzuändern. Das ist geradezu symptomatisch für dieses Verfahren: Die Vorwürfe der Anklage änderten über die Jahre immer wieder. Fiel eine Variante in sich zusammen, konstruierte man flugs eine neue.
Im ersten Prozess wurde Erwin Sperisen verurteilt, weil er in El Pavón eigenhändig Häftlinge erschossen haben soll. Da diese Version jeder Evidenz spottete – sie war weder mit den fotografierten Schussverletzungen noch mit dem zeitlichen Ablauf in Einklang zu bringen –, warf man Sperisen in zweiter Instanz eine angebliche Passivität vor. Sperisen hätte demnach den operationellen Chef der Polizei und den Vollzugschef bei einem Mordkomplott gewähren lassen, den diese im Auftrag des Innenministers ausgeheckt und vollzogen haben sollen. Nur wurden sämtliche dieser angeblichen Verschwörer in Spanien, Österreich und Guatemala freigesprochen.
Verschwörung in drei Versionen
Wie das Bundesgericht inzwischen festgehalten hat, kann sich die Genfer Justiz nicht einfach über die Freisprüche hinwegsetzen. Der Staatsanwalt zauberte deshalb eine neue, dritte Version aus dem Hut: Erwin Sperisen soll als politischer Chef der Polizei seine Garantenpflicht verletzt und die Morde – wer auch immer sie zu verantworten hat – durch «Unterlassung» ermöglicht haben. Die Anklage versinkt damit definitiv im Sumpf der Beliebigkeit: Irgendwann muss Sperisen irgendwen bei irgendeinem Mordplan irgendwie gedeckt haben. Das war dem Gericht dann doch zu viel des Ungefähren.
Der zweite Verhandlungstag führte mitten ins Elend, das über dem ganzen Prozess lastet wie ein böser Fluch. Befragt wurden die beiden spanischen Polizisten Luis Modrego und Fernando Toledo, die als Mitglieder der internationalen Untersuchungskommission Cicig in Guatemala für Recht und Ordnung sorgen sollten. Modrego sprach von zwei paramilitärischen Einheiten, einer Art Parallelpolizei, die notabene dem freigesprochenen Innenminister unterstellt waren und die seiner Meinung nach für die Exekutionen verantwortlich waren. Polizeichef Sperisen wäre demnach beim Mordkomplott gar nicht direkt beteiligt. Es gibt auch keinen direkten Zeugen, der dies behaupten würde, doch Luis Modrego erscheint es «einfach logisch», dass der politische Chef involviert war.
Die Gerichtspräsidentin ermahnte die Verteidiger mehrmals, die spanischen Ermittler nicht nach ihrer subjektiven Meinung zu fragen. Doch mehr als ihre Meinung konnten sie gar nicht kundtun. Nichts ist überprüfbar. Wir wissen nicht, wer die Kronzeugen selektionierte, die Modrego von irgendwem «zugeführt» («enviado») bekam (was das Gericht fälschlicherweise mit «von ihm ermittelt wurden» übersetzte). Wir kennen nicht einmal die Namen der Kronzeugen, die der Spanier «in Bars und Restaurants» befragt haben will. Wir wissen nicht, was sie genau sagten und zu welchem Preis. Klar ist inzwischen nur: Gratis sagte keiner aus. Wer die Regierung belastete, wurde mit Haftverschonung und grosszügigen Zeugenschutzprogrammen belohnt. Diese Deals waren so geheim, dass es sie offiziell nicht gab. Im Verlaufe des Verfahrens wurde allerdings klar, dass die ganze Untersuchung auf solchen Kronzeugenregelungen basiert. Das ist in Anbetracht der in Guatemala herrschenden Gesetzlosigkeit zwar nachvollziehbar, impliziert aber a priori, dass Sperisen schuldig ist. Der perfekte Zirkelschluss.
Geradezu vernichtend waren die Aussagen des zweiten Polizisten, Fernando Toledo – und zwar für Staatsanwalt Bertossa, der die beiden Spanier als Zeugen der Anklage vorgeladen hatte. Nachdem das Bundesgericht einen zweiten Zeugen bereits ausgeschlossen hatte, war Toledo der einzige, der noch etwas zu den drei getöteten Häftlingen von El Infiernito hätte sagen können. Die Beweislage ist in diesem Fall noch dürftiger als im Fall El Pavón. Während die erste Instanz zu einem Freispruch gelangt war, befand die Berufungsinstanz, dass Erwin Sperisen bei der Folterung und Tötung der drei Häftlinge sogar persönlich mit Hand angelegt habe. Letzterer Vorwurf fällt nach dem Verdikt des Bundesgerichtes ohnehin ausser Betracht.
Anders als Toledo noch vor drei Jahren in einer Einvernahme gegenüber Bertossa behauptete, will der Fahnder heute gar nicht mehr mit den Ermittlungen im Fall El Infiernito zu tun gehabt haben. Diese habe ein Leutnant namens Jesús Fernández geführt, der aber nie befragt wurde. Was er selber damals in Genf zu Protokoll gegeben habe, seien bloss Informationen «gemäss Hörensagen» gewesen. Doch nicht einmal daran will sich Toledo heute noch erinnern. Und das mit gutem Grund: Ihm selber droht nun ein Strafverfahren wegen falschen Zeugnisses. Sperisens Verteidiger hatten nämlich ein Protokoll gefunden aus einem Parallelverfahren bei der Audiencia Nacional in Madrid, wo Fernando Toledo vor einem Jahr eingeräumt hatte, dass er nie in die Untersuchung um El Infiernito involviert gewesen war.
Ein Telefonat zwischen dem angeblichen capo eines Todesschwadrons und Sperisen war das einzige Indiz, das im Fall El Infiernito noch vorlag. Wie Toledo gegenüber der zusehends ungehaltenen Gerichtspräsidentin nach einigem Hin und Her einräumte, hatte er die ominöse Anrufliste, auf der das Telefonat aus dem Jahr 2005 angeblich dokumentiert war, «physisch» nie gesehen. Ein Bekannter von der Telefongesellschaft Telefonica soll für ihn die Liste – fünf Jahre nach dem Telefonat notabene – im Computersystem entdeckt haben. Aus «reiner Neugierde» habe er ihn um diesen Gefallen gebeten. Abgesehen davon, dass es gar nicht die Rufnummer des capo gewesen sei, sondern die eines Kollegen von diesem, passte sie nicht zu Telefonica, sondern zu Tico, der Konkurrenz. Seines Wissens habe man die Spur nicht weiter verfolgt.
Das ist es, was von der Anklage wegen zehnfachen Mordes nach all den Jahren übrig bleibt. Mit dem Zeugen Fernando Toledo wurde die Beweisaufnahme am Dienstagabend abgeschlossen. Bei Redaktionsschluss standen die Plädoyers der Parteien und das Urteil noch aus. Vor Prognosen sei gewarnt. Die Genfer Justiz ist immer für eine Überraschung gut.?
(Copyright Weltwoche Ausgabe-Nr. 16/2018, Seite 46)
14. Und keiner ist verantwortlich
03. Mai 2018 - Das Genfer Appellationsgericht hat eine dritte Tatversion entwickelt, um Erwin Sperisen zu verurteilen. Der nicht erbrachte Schuldbeweis wurde strafmindernd berücksichtigt, der ehemalige Polizeichef bleibt auf freiem Fuss. Das Bundesgericht soll nun entscheiden. Von Alex Baur
Manchmal ist es wirklich schade, dass in Schweizer Gerichtssälen keine Kameras zugelassen sind. Die versteinerten Mienen, mit denen die sechs Mitrichter der «Chambre pénale d’appel et de révision» in Genf die Urteilseröffnung von Gerichtspräsidentin Alessandra Cambi Favre-Bulle über sich ergehen liessen, sie hätten ein monumentales Bild für die Geschichtsbücher abgeben. Das Entsetzen stand ihnen ins Gesicht geschrieben.
Die sechs Richter waren nicht zu beneiden. Sie hatten über Menschenleben zu verfügen, nicht nur in Bezug auf den Angeklagten. Sprachen sie Erwin Sperisen schuldig, ruinierten sie die Existenz eines vielleicht Unschuldigen und damit einer ganzen Familie. Denn harte Beweise für die Schuld des ehemaligen Polizeichefs von Guatemala gibt es keine. Sprachen sie ihn aber frei, dann desavouierten sie ein Dutzend Genfer Richter und Justizbeamte, die Erwin Sperisen aufgrund der morschen Grundlage früher zu «lebenslänglich» verurteilt hatten und nun die Urteilsverkündung von der gegenüberliegenden Empore als stumme Zeugen mit spitzen Ohren verfolgten.
Richter sitzen am längeren Hebel
Eine existenzielle Niederlage wäre ein Freispruch auch für Staatsanwalt Yves Bertossa gewesen, der Sperisen im August 2012 verhaften liess und sich damit selber unter Erfolgsdruck setzte. Das galt erst recht für Gerichtspräsidentin Cambi Favre-Bulle, die den Angeklagten partout nicht aus der Untersuchungshaft entlassen wollte, bis das Bundesgericht im letzten Herbst sie dazu zwang. Sie alle hätten fortan mit dem Makel leben müssen, einen Unschuldigen fünf Jahre lang in eine Zelle gesperrt zu haben. Schadenersatz und Genugtuung in Millionenhöhe stehen zur Debatte.
Erwin Sperisen selber tat nichts, um das Dilemma zu entschärfen. Im Gegenteil. Seine innerhalb und ausserhalb des Gerichtssaals geäusserte Kritik an der Genfer Justiz war ätzend. Er sah keinen Anlass für Entgegenkommen oder Selbstkritik. In seinem Schlusswort verlangte der Angeklagte gar Bertossas Rücktritt. Aus seiner Warte mag das nachfühlbar sein. Fünf Jahre unschuldig – ja, die Unschuldsvermutung bis zum Beweis des Gegenteils gilt auch für einen guatemaltekischen Polizeichchef – in einer 9,4 Quadratmeter grossen Zelle sind eine bittere Erfahrung. Ob das strategisch und psychologisch klug war, ist eine andere Frage. Die Richter sitzen am längeren Hebel, sie haben das allerletzte Wort.
Die Juristerei gibt sich gerne als Wissenschaft, welche unbesehen von Herkunft und Ansehen der Rechtsunterworfenen die Argumente sorgfältig gegeneinander abwägt, bis sie zu einem schlüssigen Resultat gelangt. Im Regelfall funktioniert das tadellos. Doch Richter sind keine Roboter. Wie alle anderen Menschen folgen sie ihrem ureigenen Überlebensinstinkt und dem sozialen Druck, wenn es um die eigene Haut geht.
Die hochemotionalen Plädoyers beider Parteien haben dies in seltener Deutlichkeit vor Augen geführt. Mangels belastbarer Beweise und konkreter Indizien wurde hüben wie drüben mit Insinuationen, Mutmassungen, persönlichen Angriffen und rhetorischen Tricks gefochten. Mit Juristerei hatte das Psycho-Gefecht nur noch am Rande zu tun.
Auf den ersten Blick glaubt man es mit einem klaren Fall zu tun zu haben. Sieben Häftlinge wurden 2006 ermordet bei einer Gefängnisrazzia, die auch unter dem Kommando der Polizei stand. Aber eben nur zum Teil. Die Armee, das Gefängnispersonal, Geheimdienste und Sondertruppen des Innenministeriums hatten die Hände mit im Spiel. Die Genfer Justiz verwendete viel Zeit und Energie für die Frage, ob die Häftlinge hingerichtet wurden, als sie sich bereits ergeben hatten. Vieles spricht dafür. Doch die wirklich diffizile und alles entscheidende Frage wurde nur rudimentär und in plakativen Allgemeinplätzen abgehandelt: Welche Rolle spielte Sperisen, der politische Chef der Polizei, in diesem Komplott?
Die undurchsichtige, lückenhafte und politisch kontaminierte Untersuchung aus Guatemala lieferte zwar eine barocke Fülle an widersprüchlichen Gerüchten und Behauptungen, aber kaum belastbare Beweise. Sperisen konnte oder wollte die Lösung auch nicht präsentieren. Doch in einem zivilisierten Rechtssystem liegt es nicht am Angeklagten, seine Unschuld zu beweisen. Am Ende gilt der Grundsatz «in dubio pro reo».
Gute Freunde haben keine Geheimnisse
Der Ruch des Politischen lastete von allem Anfang an über dem Verfahren. Je krampfhafter man den Anschein der Befangenheit zu unterdrücken versuchte, desto offenkundiger wurde er. Die Politkomponente ist auch mit kühnster «juristischer Akrobatik» (Le Temps) nicht aus der Welt zu reden: Das Verfahren, das sich im Kern gegen die rechtskonservative damalige Regierung von Oscar Berger richtete, wurde angestossen und vorangetrieben von Aktivisten der NGO Trial, die mit der linken Szene in Guatemala ebenso verbandelt ist wie mit dem Genfer Politik- und Justizbetrieb.
Staatsanwalt Bertossa sagte es frank und frei in seinem Schlussplädoyer: Erwin Sperisen stand vor den Schranken stellvertretend für eine weisse Oberschicht, welche das mehrheitlich indianische Volk von Guatemala angeblich unterjocht und ausbeutet wie zu Kolonialzeiten. Bertossa war zwar noch nie in diesem Land, er hat seine Rassentheorie nie in der Praxis überprüft. Aber in der Weltstadt Genf gibt es schliesslich viele Hilfswerke, Soziologen und Professoren, die täglich verkünden, was in der Dritten Welt so vor sich geht.
Nichts scheut das Bundesgericht mehr als Politik. Zwei Jahre lang brüteten die Juristen in Lausanne über dem Fall. Es resultierte ein Verdikt von rekordverdächtigen hundert Seiten, das die gravierenden Mängel im Genfer Urteil gegen Sperisen rügt: Missachtung von Verteidigerrechten, Willkür in der Begründung, Verletzung der Unschuldsvermutung. Doch das Bundesgericht liess auch vieles im Ungewissen. Die entscheidende Frage blieb offen: Wurden die Exekutionen auf Befehl oder zumindest mit der Einwilligung des Polizeichefs vollzogen? Das Bundesgericht schob damit die Verantwortung zurück nach Genf.
Den ursprünglichen Schuldspruch mit den Trümmern zu begründen, die das Bundesgericht vom Verfahren übriggelassen hatte, wäre kühn gewesen. Noch mehr Überwindung hätte es gebraucht, Sperisen freizusprechen und zu entschädigen. Es wäre ein juristischer Bankrott gewesen. Das Gericht entschied sich für einen dritten Weg: Erwin Sperisen ist halb schuldig. Er habe den mörderischen Plan zwar nicht ausgeheckt, er habe bei dessen Ausführung auch nicht mitgewirkt, aber Erwin Sperisen habe die Killerkommandos gewähren lassen. Die Strafe wurde auf fünfzehn Jahre reduziert.
«Genf hat die Kritik an der mangelnden Beweisführung erhört und deshalb auf eine lebenslange Haftstrafe verzichtet», kommentierte die «Tagesschau» von SRF das Verdikt. Man könnte es auch direkter formulieren: Für den Fall, dass Sperisen doch unschuldig wäre, muss er weniger lang hinter Gitter.
Das Urteil folgt der Taktik von Staatsanwalt Yves Bertossa, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Verfahren zieht. Fiel eine Version in sich zusammen, konstruierte er flugs eine neue. So waren im jüngsten Prozess drei weitere Morde aufgeführt, der sogenannte Fall «El Infiernito», für die Sperisen in erster Instanz noch freigesprochen worden war. Bertossa liess den spanischen Ermittler Fernando Toledo, der in diesem Dossier als Schlüsselzeuge figuriert, extra nach Genf einfliegen. Als Toledo im Zeugenstand einräumen musste, dass er gelogen hatte – tatsächlich war er in die Ermittlungen von «El Infiernito» nie involviert gewesen –, liess Bertossa die Anklage in diesem Nebendossier kommentarlos fallen. Das mag auf den ersten Blick grosszügig anmuten. Doch mit diesem Schachzug eliminierte er elegant eine Falschaussage aus dem Prozess, die den tendenziösen Charakter der Ermittlung entlarvt.
Gemäss dem ersten Genfer Urteil hatte Erwin Sperisen bei den Exekutionen aktiv selber Hand mit angelegt. Diese Version basierte im Wesentlichen auf den Anschuldigungen des Mörders Philippe Biret, der sich Bertossa als Kronzeuge angedient hatte und dafür in Guatemala mit einer vorzeitigen Haftentlassung belohnt wurde. Birets Behauptung stand in einem derart hanebüchenen Widerspruch zu den Fakten, dass die Berufungsinstanz sie eliminierte. Gemäss dem zweiten Urteil machte sich Sperisen gerade dadurch verdächtig, dass er sich passiv im Hintergrund hielt. Das Gericht begnügte sich mit Staatsanwalt Bertossas simpler Formel: «Die Chefs kommandieren, die Untergebenen exekutieren.»
Und nun also eine dritte Variante. Sie stellt die Hierarchie auf den Kopf. Nicht Sperisen, der Chef, sondern sein Untergebener Javier Figueroa habe die Hinrichtung der Häftlinge geplant und kommandiert. Diese Version stützt sich im Wesentlichen auf die Aussage des Geheimdienstlers und Kronzeugen Luis Linares Pérez, der bei der Schiesserei mitgewirkt hatte und für seine mehrfach revidierten Aussagen mit Haftverschonung und einem kanadischen Arbeitsvisum belohnt wurde.
Sperisen und Figueroa hatten sich vor der Gefängnisrazzia bei einer Tankstelle und nach der Schiesserei am Ort des Geschehens getroffen, wobei unter anderem auch Kommandoeinheiten zugegen gewesen waren. Was besprochen wurde, ist nicht überliefert. Dass Erwin Sperisen und Javier Figueroa seit ihrer Kindheit befreundet sind, war für das Genfer Appellationsgericht Beweis genug, dass sie keine Geheimnisse voreinander hätten.
Gespenstische Parallelen
Nun gibt es aber ein Problem: Javier Figueroa wurde 2013 in Österreich nach einem aufwendigen Geschworenenprozess in exakt derselben Sache von Schuld und Strafe freigesprochen. Irgendwelche neue Erkenntnisse, die ein neues Verfahren rechtfertigen würden, kamen seither nicht hinzu.
Das Bundesgericht hat in diesem Punkt festgehalten, dass sich die Genfer Richter nicht ohne weiteres über diesen Freispruch hinwegsetzen dürfen. Denn damit würden sie neben der Unschuldsvermutung den fundamentalen Rechtsgrundsatz «ne bis in idem» (kein zweiter Prozess in derselben Sache) verletzen. Bindend sei das österreichische Urteil für die Schweiz freilich auch nicht.
Das Bundesgericht soll nun erklären, was gilt. Bis dahin bleibt Erwin Sperisen auf freiem Fuss. Die Genfer Justiz hat damit die Entscheidung elegant nach Lausanne zurückdelegiert. Der seit sechs Jahren vor sich hin gammelnde Prozess, der inzwischen den halben Sperisen-Clan mit ins Elend gestürzt hat, entwickelt zusehends gespenstische Parallelen zu den Lynchmorden in Guatemala: Ungeheuerliches hat sich zugetragen, so viel steht fest, doch keiner ist dafür verantwortlich.
(Copyright Weltwoche, Ausgabe-Nr. 18, Seite 34)
15. Guatemala unterstützt Sperisen
09. August 2018- Erwin Sperisen zieht von Genf nach Bern, wo seine Frau Elisabeth seit Anfang Juli für die Botschaft von Guatemala arbeitet. In Spanien wurde derweil der letzte vermeintliche Mitverschwörer definitiv freigesprochen. Der Prozess gegen den ehemaligen Polizeichef kippt ins Surreale. Von Alex Baur
Die Order kam direkt aus dem Präsidentenpalast: Nach der erneuten Verurteilung von Erwin Sperisen in Genf vom letzten April nahm sich Jimmy Morales, das Staatsoberhaupt von Guatemala, persönlich der Sache an. Morales bot Elisabeth Sperisen, der Gattin des ehemaligen Polizeichefs, eine Stelle bei der guatemaltekischen Botschaft in Bern an. Seit dem 2. Juli betreut sie dort nun die konsularischen Belange. Deutlicher lässt sich die Konsternation in Guatemala über den Genfer Polit-Prozess kaum ausdrücken. Am 15. August zügelt die ganze Familie von Genf nach Bern.
Der Fall Sperisen kippt damit vollends ins Surreale. Als der Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa im August 2012 den ehemaligen Polizeichef von Guatemala in einer theatralischen Aktion verhaften liess, so als wäre dieser ein Terrorist, wollte er der Welt zeigen, wie man in einer fernen Bananenrepublik für Recht und Ordnung sorgt. Doch während sich Bertossas Kronzeugen in heillose Widersprüche verstrickten, wurde in Österreich, Spanien und Guatemala ein vermeintlicher Mitverschwörer nach dem andern freigesprochen. Hat sich Erwin Sperisen, der am Schluss als Einziger übrigblieb, mit sich selber verschworen?
Zu fünft in einer Einzimmerwohnung
Letzte Woche hat das oberste Gericht Spaniens den Freispruch von Ex-Innenminister Carlos Vielmann bestätigt. Die ganze Führungscrew ist damit rehabilitiert, ausser Sperisen. Das mutet umso absurder an, als ihm inzwischen nicht einmal mehr die Genfer Justiz eine direkte Beteiligung am Massaker im Gefängnis El Pavón unterstellt. Gemäss der neuen Version soll Sperisen als politischer Chef der Polizei die Freigesprochenen lediglich gedeckt haben. In Guatemala selber, wo der Genfer Prozess sehr aufmerksam verfolgt wird, sorgte das Verdikt für Kopfschütteln und Empörung.
Sperisens Anwälte haben nun bis Mitte September Zeit, ihre Anfechtung gegen das Genfer Urteil beim Bundesgericht zu begründen. Ihr Fokus liegt auf der Europäischen Menschenrechtskonvention. Falls sie in Lausanne abblitzen, ist der Gang nach Strassburg gewiss. Doch für die fünfköpfige Familie, die seit Jahren zusammengepfercht in einer Einzimmerwohnung der Genfer Sozialbehörden haust, verbessert sich einiges. Die drei Kinder bekommen endlich Schlafzimmer, sie müssen sich nicht mehr einen kleinen Küchentisch für die Hausaufgaben teilen. Die behördlichen Schikanen, denen der ganze Sperisen-Clan in Genf ausgesetzt war, scheinen mit dem Umzug nach Bern ein Ende zu nehmen.
Aseptische Begründung über 146 Seiten
Erwin Sperisen bleibt weiter unter Hausarrest, den die Genfer Justiz vor einem Jahr verfügte, nachdem sie ihn auf Befehl des Bundesgerichtes aus der Untersuchungshaft entlassen musste. Rund um die Uhr überwacht durch eine Fussfessel, wird er sich fortan in Bern zweimal pro Woche bei der Polizei melden müssen. Sorgen bereitet ihm vor allem die Gesundheit. Fünf Jahre Isolationshaft und der damit verbundene Mangel an Bewegung haben seinen Diabetes verschlimmert. Derselbe Justizapparat, der den Lustmörder Fabrice Anthamatten zur Pferdetherapie und damit seine Betreuerin Adeline M. in den Tod schickte, hatte dem angeblich hochgefährlichen Erwin Sperisen während fünf Jahren ungeachtet aller ärztlichen Appelle eine sportliche Betätigung im Gefängnis von Champ-Dollon verweigert.
Immerhin macht das Genfer Appellationsgericht nun vorwärts. Offenbar möchte man das leidige Kapitel schliessen. Anfang Juli, rekordverdächtige zwei Monate nach der Hauptverhandlung, lag bereits eine 146 dicke Urteilsbegründung vor. Das Bundesgericht hatte für dasselbe Dossier zwei Jahre gebraucht. Sperisens Verteidiger vermuten, dass die Urteilsbegründung in grossen Teilen bereits vorlag, als der dritte Prozess Ende März über die Bühne ging. Zumindest jene Richter, die in letzter Minute noch eingewechselt wurden, konnten den Aktenberg gar nicht studiert haben.
Wie Sperisen-Verteidiger Giorgio Campa einräumt, hebe sich die neue Begründung von den früheren Urteilen ab: «Das Ganze ist nicht mehr so irr» («moins délirant»). Anders als früher werden im neuen Verdikt Widersprüche gegeneinander abgewogen, da und dort auch Einwände und Ausführungen des Angeklagten mit einbezogen oder zumindest erwähnt. Auch formal ist das neue Urteil, welches der Weltwoche vorliegt, übersichtlicher und nachvollziehbar aufgegliedert.
Gerade hier liegt gemäss Campa allerdings auch eine gewisse Perfidie: Die haarsträubendsten Unstimmigkeiten in den Aussagen der Hauptzeugen und eklatanten Lücken in den nicht überprüfbaren Ermittlungen der halbstaatlichen Untersuchungskommission (Cicig) im fernen Guatemala sind nach der Rüge des Bundesgerichtes aus dem Recht gefallen. Nur sind sie damit nicht aus der Welt geschafft. Sie sind bloss nicht mehr erkennbar.
Dass 2006 bei einer Grossrazzia im Gefängnis El Pavón mehrere Häftlinge von privaten Sonderkommandos hingerichtet wurden, steht gemäss Bundesgericht fest. Die Führer dieser Kommandos – Victor Rivera und die Gebrüder Benitez – sind bekannt. Nur wurden sie nie ins Recht gefasst oder befragt, zumal sie später alle selber ermordet wurden. Die zentrale Frage ist eine andere: Hatte Erwin Sperisen, der als politischer Chef der Polizei keine Befehlsgewalt über die Kommandos innehatte, mit den Exekutionen zu tun?
Der neue Schuldspruch aus Genf stützt sich im Wesentlichen auf die Aussagen von zwei Kronzeugen – Luis Linares und Leonel Jocol –, die von der Cicig mit Strafverschonung und einem Einreisevisum nach Kanada für die ganze Familie belohnt wurden. Letzteres wurde allerdings erst bekannt, als die beiden ihre Aussagen in Genf bereits deponiert hatten. Nach Meinung der Genfer Richter ist dieser Aspekt aber unerheblich, da ein Exil ebenso als Nachteil empfunden werden könne. Widersprüche in den Aussagen dieser Kronzeugen machten diese im Übrigen nicht als Ganzes unglaubwürdig.
Keiner der Kronzeugen belastet Erwin Sperisen direkt. Er befand sich zur fraglichen Zeit nachweislich nicht im Umfeld des Geschehens, sehr wohl aber – neben Dutzenden von Uniformierten aller Gattungen – der Polizeikommandant Javier Figueroa. Figueroa, ein Jugendfreund von Sperisen, hatte den Auftrag, den betreffenden Sektor zu überwachen. Nach Meinung der Genfer Richter konnten ihm die Machenschaften der Kommandos nicht entgangen sein. Folglich musste Sperisen von den Exekutionen erfahren und zumindest nichts dagegen unternommen haben.
Aus welchen Gründen die Häftlinge erschossen wurden, bleibt offen. War es eine Abrechnung unter «Narcos»? Figueroa führte später eine Ermittlung gegen den Kommandochef Victor Rivera, wie im Urteil erwähnt wird, allerdings in einem anderen Zusammenhang. Verbindungen ins Drogenmilieu hatten sicher auch die als Mitarbeiter der US-Drogenbehörde DEA bekannten Benitez-Brüder. Hatte der oberste Vollzugschef Alejandro Giammattei die Killer auf die Häftlinge angesetzt, weil diese ihn und seine Familie vor der Razzia mit dem Tod bedroht hatten? Tatsache ist, dass die meisten Toten der obersten Knasthierarchie angehörten. Hat man sie eliminiert, um die Kontrolle über das Gefängnis wieder- zuerlangen? Vieles ist denkbar, nichts lässt sich nachweisen.
Bezüglich Sperisens Motiven fehlt im aseptischen Urteil jegliche Erwägung: Sie bleiben unbekannt, seien aber auf jeden Fall «nicht altruistisch» gewesen. Zwar ist auch den Genfer Richtern nicht entgangen, dass sich Guatemala nach drei Jahrzehnten Bürgerkrieg in einem Zustand allgemeiner Verwahrlosung und des Faustrechtes befand. Umso mehr wäre es Sperisens Aufgabe gewesen, so die Belehrung aus den Genfer Amtsstuben, dem inexistenten Rechtsstaat Nachachtung zu verschaffen. Strafverschärfend wurde dem Angeklagten sodann vorgehalten, dass er Kritik an den «Protagonisten, internationalen Organisationen und juristischen Autoritäten» geübt und damit deren Ansehen «beschmutzt» («salir») habe. Wie das Gericht zum Strafmass von 15 Jahren Gefängnis kam, wird nicht weiter ausgeführt. Es entspricht einfach Bertossas Antrag.
Schuld auf den Abwesenden verlagert
Die Umlagerung der Hauptschuld auf den operativen Kommandanten Javier Figueroa hat einen Haken: Sperisens «Jugendfreund» wurde 2013 nach einem aufwendigen Geschworenenprozess in Österreich rechtsgültig freigesprochen – und zwar in exakt derselben Sache, für die er in Genf nun in Abwesenheit summarisch verurteilt wurde, ohne dass man ihn auch nur angehört hätte. Irgendwelche neue Beweise oder Erkenntnisse hat es seit dem österreichischen Prozess keine gegeben.
Die Genfer Richter sahen keinen Anlass, die Qualität der Untersuchung der Cicig anzuzweifeln: «Es handelt sich dabei um eine Institution, die das Ziel verfolgt, die Probleme zu bekämpfen, die den guatemaltekischen Staat bedrohen.» Wenn dieses Ziel vorgegeben war, dann wurde es auch erfüllt. Den Freispruch der österreichischen Geschworenen erklärten die Richter dagegen mit einem Federstrich zur Makulatur.
Das Bundesgericht muss nun entscheiden, wem es mehr Gewicht einräumt: einem unabhängigen Gericht in Österreich oder einem lateinamerikanischen Juristengremium in Guatemala, das formell zwar unabhängig agiert, aber nur auf Geheiss der jeweiligen Regierung ermitteln darf.
(Copyright Weltwoche Ausgabe-Nr. 32/2018, Seite 36)
16. Käserepublik im Abseits
15. August 2019 - Gemäss der Genfer Justiz ist Alejandro Giammattei ein Massenmörder. Doch hat das Volk von Guatemala diesen Mann zu seinem Staatsoberhaupt gewählt. Peinlich für die Schweiz.
Das Resultat liess an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Mit rund 20 Prozentpunkten Vorsprung auf seine Rivalin Sandra Torres wurde der Arzt Alejandro Giammattei am letzten Sonntag zum neuen Staatspräsidenten von Guatemala gewählt. Der klare Sieg mag aus mehreren Gründen überraschen. Zum einen erscheint fraglich, ob der an multipler Sklerose erkrankte rechtskonservative Politiker die vierjährige Amtszeit überhaupt überleben wird. Zum andern wurde Giammattei in Genf für schuldig befunden, als damaliger Chef der Strafvollzugsbehörde anlässlich einer Gefängnisrazzia 2006 die Hinrichtung von sieben inhaftierten Gangstern angeordnet zu haben.
In Guatemala selber wurde Alejandro Giammatei 2014 zwar von Schuld und Strafe freigesprochen. Seine vermeintlichen Komplizen, Innenminister Carlos Vielman und der Polizeikommandant Javier Figueroa, wurden in Spanien und Österreich entlastet und rehabilitiert. Doch die Genfer Justiz, die in diesem Fall über einen vierten Beschuldigten zu urteilen hatte, war anderer Meinung: Sie verurteilte Erwin Sperisen, den damaligen politischen Chef der Polizei, wegen mehrfachen Mordes. Und weil man die Exekutionen Sperisen nicht direkt anlasten konnte und eine Verschwörung mindestens zwei Akteure braucht, verurteilten die Genfer Richter kurzerhand auch die im Ausland Freigesprochenen – in Abwesenheit, ohne dass sie sich verteidigen konnten.
Seit bald sieben Jahren wird das Verfahren gegen Erwin Sperisen in den Schweizer Justizkabinetten hin- und hergeschoben. Dreimal wurde er verurteilt, mal als Haupttäter, mal als Mitläufer, dann bloss noch als Mitwisser, mit Begründungen, die widersprüchlicher kaum hätten sein können. Seit einem Jahr gammelt das Dossier nun wieder beim Bundesgericht vor sich hin. Die Akten der internationalen Ermittlungskommission Cicig, welche das Gefängnismassaker in Guatemala unter dem Schirm der Uno hätte aufklären sollen, strotzen nur so vor Widersprüchen, Lücken und Verkehrungen. Ein bunter Strauss von Gerüchten kontrastiert mit einem eklatanten Mangel an Beweisen.
Mit Händen und Füssen wehren sich die Genfer Richter und Staatsanwälte gegen den überfälligen Freispruch. Die Blamage wäre kolossal. Anstatt der Welt zu zeigen, wie man Justiz macht, müsste Genf, die gefühlte humanitäre Welthauptstadt, Erwin Sperisen für fünf Jahre unschuldig erlittene Beuge- und Untersuchungshaft in totaler Isolation mit einem Betrag in Millionenhöhe entschädigen. Doch auch für die Schweiz wird der vermeintliche Musterprozess zusehends zum Albtraum. Immerhin hat das Aussendepartement (EDA) die Cicig seit Jahren massgeblich mitfinanziert.
Justiz als Bedrohung für den Rechtsstaat
In Guatemala selber haben die internationalen Uno-Ermittler längst jedes Vertrauen verloren. Die von politischen Machenschaften geprägten Verfahren der Cicig führen kaum je zu belastbaren Urteilen. Die Cicig wurde damit vielmehr zu einer zusätzlichen Bedrohung für den ohnehin schwachen Rechtsstaat in Guatemala. Willkür, Korruption und Verletzung der Menschenrechte sind zweifellos eine allgegenwärtige Geisel im zentralamerikanischen Land. Doch die Polit-Prozesse der Cicig sind davon nicht ausgenommen, sondern ein Teil davon. Die noch amtierende Regierung von Jimmy Morales hat die internationalen Ermittler deshalb des Landes verwiesen.
In Guatemala gilt der ehemalige Polizeichef Erwin Sperisen als Opfer einer aus dem Ausland gesteuerten Polit-Justiz. Mit Argusaugen und wachsender Konsternation verfolgt man die kafkaeske Justizakrobatik der Genfer Gerichte. Die Kommentare der 34 782 Follower auf Sperisens Facebook-Account sprechen für sich: Die Bananenrepublik scheint ihr Pendant in der Käserepublik jenseits des Atlantiks gefunden zu haben. Bereits vor einem Jahr stellte die guatemaltekische Regierung Sperisens Ehefrau Elisabeth als Botschaftssekretärin in Bern ein. Es war ein demonstrativer Fingerzeig an die Adresse der offiziellen Schweiz: In Guatemala ist Erwin Sperisen rehabilitiert.
Die Wahl des vermeintlichen Massenmörders Alejandro Giammattei zum Staatsoberhaupt setzt dem Justizdebakel die Krone auf. Die Machenschaften der von der Schweiz mitfinanzierten Cicig waren im Wahlkampf durchaus ein Thema – und das offenbar nicht zu Ungunsten des rechtskonservativen Giammattei. Dabei hatte der damalige Vollzugschef 2006 als Einziger ein handfestes Motiv, die inhaftierten Gangsterbosse durch ein Killerkommando umbringen zu lassen: Sie hatten ihn und seine Familie im Vorfeld einer geplanten Gefängnisrazzia mit dem Leben bedroht.
Auch Giammatteis Gegnerin, die Sozialistin Sandra Torres, stand schon auf Kriegsfuss mit der Cicig. Gemäss einem Bericht, der allerdings keine Konsequenzen hatte, soll sie zusammen mit ihrer Schwester Gloria 2007 den Wahlkampf ihres damaligen Gatten Alvaro Colom mit Geldern des berüchtigten Zeta-Kartells finanziert haben. Kaum zum Präsidenten gewählt, setzte Colom die Cicig auf die Vorgängerregierung an. Er lenkte damit elegant von sich selber ab. Der Polit-Prozess gegen Giammattei und Sperisen war das Resultat davon. Der Kreis schliesst sich.
(Copyright Weltwoche Ausgabe-Nr. 33/2019, Seite 11)
17. Justiz im Unrechtsstaat
05. Dezember 2019 - Das Bundesgericht hat dem Sperisen-Prozess nach sieben Jahren ein Ende gesetzt mit einem Schuldspruch, der keine Klärung bringt. Der Versuch, von Genf aus für Recht und Ordnung in Guatemala zu sorgen, ist gescheitert. Ein Lehrstück über die Grenzen der Justiz. Von Alex Baur
Die Reaktionen in Genf auf das Verdikt aus Lausanne waren seltsam verhalten, die Meldungen in den Medien auffällig kurz. Dabei hatte die vielgescholtene Genfer Justiz mit der Verurteilung von Erwin Sperisen, dem ehemaligen politischen Chef der Polizei in Guatemala, zu fünfzehn Jahren Gefängnis doch einen langersehnten Erfolg in einem Prestigefall erzielt. Doch niemand schien sich richtig zu freuen. Zu viele Rechtsbrüche, Widersprüche und Irrungen waren während des siebenjährigen Prozesses ans Tageslicht gekommen, als dass man der Sache noch trauen konnte.
Fati Mansour, gefühlte Doyenne der Westschweizer Gerichtsreporter und wohltemperiertes Sprachrohr der Genfer Strafverfolger, lobte in Le Temps den «essenziellen Prozess», der die internationale Verfolgung von Verbrechen einen Schritt weitergebracht habe. Dass es dafür einer «eher akrobatischen» Rechtsauslegung bedurfte, war indes auch ihr nicht entgangen. Mansour erinnerte an den russischen Oligarchen Sergei Michailow, den die Genfer Justiz vor zwanzig Jahren für die unschuldig erlittene U-Haft mit 800 000 Franken entschädigen musste. Eine solche Schmach blieb Genf diesmal erspart.
Doch Mansour irrt doppelt. Erstens ist der Fall um den schweizerisch-guatemaltekischen Doppelbürger Erwin Sperisen derart singulär, dass er sich kaum wiederholen wird. Er setzt in dieser Hinsicht kein Präjudiz. Zweitens hat gerade dieser Prozess die Grenzen der internationalen Justiz aufgezeigt. Nach sieben Jahren Hin und Her ist immer noch nicht klar, wer 2006 unter welchen Umständen in einem Gefängnis im fernen Guatemala sieben Häftlinge umgebracht hat. Irgendwie soll Erwin Sperisen damit zu tun gehabt haben.
Korrupte und verpolitisierte Justiz
In Guatemala, wo die Genfer für Recht und Ordnung sorgen wollten, hat der Prozess nichts verändert. Staatspräsident Alejandro Giammattei schickte eine trotzige Solidaritätsbotschaft an Erwin Sperisen und seine Familie. Seine politischen Gegner mögen sich freuen, seine Anhänger empören sich, doch in Guatemala bezweifelt kein Mensch, dass es ein politisches Urteil war. Der Fall Sperisen ist einer von Hunderten politischen Prozessen, die das Land an die Grenzen der Unregierbarkeit getrieben haben. «Lawfare» nennt man das Phänomen jenseits des Atlantiks, eine Kombination von law (Gesetz) und warfare (Kriegsführung), die Fortsetzung der Politik mit den Waffen des Rechts.
Die hoffnungslos korrupte und verpolitisierte Justiz, ein Erbe aus drei Jahrzehnten Guerilla-Terror, stellt heute die vielleicht grösste Bedrohung für die junge Demokratie in Guatemala dar. Die Regierung von Oscar Berger (2004–2008), der auch Sperisen diente, hatte in der Not die internationale Untersuchungskommission Cicig ins Land gerufen. Sie lieferte 2010 die Grundlage für den Sperisen-Prozess. Mittlerweile ist die auch von der Schweiz finanzierte Cicig mit Schimpf und Schande aus Guatemala verjagt worden. Einige ihrer Ermittler stehen selber unter Korruptionsverdacht.
Mitverschwörer freigesprochen
Das Resultat des neunjährigen Verfahrens: Erwin Sperisen wurde in der Schweiz für schuldig befunden, 2006 in Guatemala den Polizeikommandanten Javier Figueroa nicht daran gehindert zu haben, sich anlässlich einer Gefängnisrazzia an der Ermordung von sieben Gangstern zu beteiligen. Mit der «Planung, Organisation, Anordnung, Ausführung, Leitung oder Überwachung» des Massakers, so wird im Lausanner Urteil noch einmal betont, hatte Sperisen nichts zu tun. Ihm wird lediglich vorgeworfen, Figueroa nicht aufgehalten oder zur Rechenschaft gezogen zu haben.
Das Problem: Figueroa wurde bereits 2013 in Österreich in einem aufwendigen Prozess, dem exakt dieselben Akten zugrundelagen wie dem vorliegenden, rechtskräftig freigesprochen. Sperisens Anwälte standen demnach vor der kafkaesken Situation, primär den vermeintlichen Mörder Figueroa verteidigen zu müssen, der in Genf nie angeklagt worden war, sich also weder verteidigen noch äussern konnte, da er längst freigesprochen war. Und Figueroa war beileibe nicht der einzige Störfaktor.
Gemäss der Anklage der Cicig aus dem Jahr 2010 war Erwin Sperisen Teil einer Verschwörung auf höchster Regierungsebene. Doch während in Genf der Prozess gegen ihn lief, wurden peu à peu alle vermeintlichen Mitverschwörer freigesprochen: zuerst der damalige Gefängnischef (und heutige Staatspräsident) Giammattei und sein Stellvertreter in Guatemala; dann Polizeikommandant Figueroa in Österreich; und schliesslich auch noch Innenminister Carlos Vielmann in Spanien. Am Ende blieb Sperisen als einziger Verschwörer auf Führungsebene. Hatte er sich etwa mit sich selber verschworen?
Vom gesunden Menschenverstand liessen sich die Genfer nie beirren. Sie wollten der Welt zeigen, wie man einer Bananenrepublik zum Recht verhilft. Für den vermeintlich guten Zweck haben sie mit juristischer Akrobatik so ziemlich alles überwunden, was einem Rechtsstaat heilig ist. Es war eine tollkühne Vorstellung ohne Netz, bei dem sich die Genfer Staatsanwälte und Richter selber unter Erfolgszwang setzten: Bei einem Misslingen drohte der Totalabsturz.
Das Traurigste am Prozess war, dass Sperisen nie eine Chance hatte, auch nur ernsthaft angehört zu werden. Für die Genfer Staatsanwälte und Richter stand von Anfang an fest: Ein Polizeichef von Guatemala, zumal ein weisser, ist niemals unschuldig. Gefangen in ihrer «Drittweltisten»-Romantik, glaubten sie, Guatemala besser zu kennen als die Guatemalteken. Und wenn man nicht so genau wusste, was er verbrochen haben sollte, so mögen sie sich gedacht haben, dass er selber es bestimmt wisse.
Der Bertossa-Komplex
Wer das Urteil gegen Sperisen verstehen will, muss in der Vorgeschichte suchen. Mansours Hinweis auf das Michailow-Debakel liefert den Schlüssel. Michailow lag stets wie ein stiller Schatten über dem ganzen Verfahren. Der russische Oligarch war allerdings nur einer von vielen Bösewichten im fernen Ausland, denen der Genfer Oberstaatsanwalt Bernard Bertossa (1990 bis 2002) Mores lehren wollte. Die spektakulären Coups – allen voran die 1998 von Bertossa mit initiierte Verhaftung des chilenischen Ex-Diktators Augusto Pinochet in London – bescherten Genf zwar weltweit Schlagzeilen. Doch sie endeten regelmässig in einem juristischen Scherbenhaufen.
2006 trat Yves Bertossa (SP) in Papas Fussstapfen bei der Genfer Staatsanwaltschaft. Zwei Jahre später landete Bertossa junior mit der Verhaftung von Hannibal Gaddafi seinen ersten internationalen Coup. Es war ein kolossaler Flop. Die offizielle Schweiz musste am Ende vor dem libyschen Tyrannen um Vergebung betteln. Doch die Bertossas liessen sich nicht beeindrucken. Hinter den Kulissen werkelten Vater und Sohn an einer globalen Staatsanwaltschaft mit Sitz in der Weltstadt Genf, welche unter dem Schirm der Uno Potentaten rund um den Erdball zur Strecke bringen soll.
2012 präsentierte die linke NGO Trial dem mittlerweile zum Ersten Staatsanwalt aufgerückten Yves Bertossa auf dem Silbertablett den Fall Sperisen, der all die Niederlagen der Vergangenheit vergessen lassen sollte. Die NGO hatte mit Hilfe der Cicig-Ermittler den Franzosen Philipp Biret aus Guatemala einfliegen lassen. Biret, rechtskräftig verurteilt wegen eines Doppelmordes, sass im guatemaltekischen Gefängnis El Pavon eine Gefängnisstrafe von 35 Jahren ab. Und er wollte mit eigenen Augen gesehen haben, wie Polizeichef Erwin Sperisen 2006 bei der Gefängnisrazzia einem Häftling in den Kopf geschossen habe. Yves Bertossa liess Sperisen Ende August 2012 in einer spektakulären Kommandoaktion im Zentrum von Genf verhaften. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.
Spätestens nach der zweiten Einvernahme musste Bertossa erkannt haben: Biret log, dass die Balken krachten. Nach seiner Version hatte Sperisen am Nachmittag der Razzia einem Gefangenen mit einer Pistole in den Kopf geschossen. Doch keiner der Toten wies Kopfwunden auf, alle Kugeln stammten aus Gewehren, zur fraglichen Zeit lagen alle sieben Häftlinge längst im Leichenschauhaus.
Staatsanwalt Bertossa bot Sperisen Anfang 2013 ein plea bargaining an: Wenn er sich in einem Nebenpunkt schuldig bekennte und seine Vorgesetzten belastete, würde er ihn mit einer symbolischen Strafe laufenlassen. Erwin Sperisen schlug den Kuhhandel aus. Bertossa blieb hart. Er begab sich damit in eine Einbahnstrasse, aus der es kein Zurück mehr gab. Je länger die U-Haft andauerte, desto grösser die Schmach einer Niederlage. Bald wäre ein Freispruch nicht nur für Bertossa eine persönliche Katastrophe gewesen, sondern auch für alle Richter, die sein Vorgehen deckten.
Wilde Geschichten der Kronzeugen
Bertossa hoffte, Sperisen mit einer Mischung aus Isolationshaft und der Aussicht auf Straferlass zu einem Geständnis zu bringen. Er setzte damit auf eine Taktik, auf der bereits das ganze Verfahren der Cicig in Guatemala baute: sogenannte Kronzeugen-Deals. Wer einen Vorgesetzten belastete, ging straffrei aus und wurde mit einem kanadischen Einwanderungsvisum belohnt. Die Methode funktioniert ähnlich wie Folter. Und sie hat denselben Nachteil: Die erpressten Aussagen sind das Papier nicht wert, auf dem sie protokolliert werden, sofern es keine harten Beweise gibt. Und solche gab es im Fall El Pavón nicht.
Um ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen – ein Polizist hat in einem guatemaltekischen Knast schlechte Überlebenschancen – erzählten die Kronzeugen die wildesten Geschichten. Selten passte die eine mit der andern zusammen. Sie belasteten alle möglichen Leute, nur nicht sie selber. Ausser dem Mörder Biret – er wurde für sein Lügenmärchen mit der Entlassung aus dem Gefängnis belohnt – wollte denn auch keiner direkt die Exekution von Häftlingen beobachtet haben. Das war die morsche Grundlage, auf der Erwin Sperisen verurteilt wurde, mit dem Segen des Bundesgerichtes.
Drei Mal wurde Erwin Sperisen in Genf verurteilt. Die Urteile hätten widersprüchlicher nicht sein können. In erster Instanz wurde er für schuldig befunden, einen Häftling eigenhändig erschossen zu haben. In der Berufung wurde seine Abwesenheit am Tatort als besondere Hinterhältigkeit gedeutet. Als Chef der Polizei, so die lapidare Begründung, hatte er das Kommando. Dem Gericht entging allerdings nicht, dass Vollzugschef Giammattei das Oberkommando über die Razzia hatte, an der neben der Polizei die Armee, Geheimdienste, das Vollzugspersonal und paramilitärische Trupps des Innenministeriums beteiligt waren. Also verurteilten die Genfer kurzerhand auch die vier im Ausland freigesprochenen vermeintlichen Mitverschwörer.
Fehlende Erklärungen
Das war dem Bundesgericht dann doch zu viel. Im Herbst 2017 wies es unter der Federführung von Richterin Laura Jacquemoud-Rossari den Fall mit zahlreichen Rügen zur Neubeurteilung nach Genf zurück. Nach den Rezepten aus Lausanne bastelte das Genfer Appellationsgericht unter der Leitung von Alessandra Cambi Favre-Bulle im Mai 2018 eine dritte Tatversion. Jetzt spielte Sperisen plötzlich nur noch eine passive Nebenrolle. Das Massaker wurde demnach von paramilitärischen Einheiten durchgeführt. Der in Österreich von diesem Vorwurf freigesprochene Polizeikommandant Javier Figueroa soll dabei allerdings mitgewirkt haben. Sperisen wird nur noch vorgeworfen, Figueroa gedeckt zu haben. Schliesslich war er sein Jugendfreund.
Wer genau die sieben Häftlinge unter welchen konkreten Umständen hingerichtet haben soll, lässt indes auch das Bundesgericht offen. Die namentlich bekannten Anführer der paramilitärischen Trupps – Victor Rivera sowie die Gebrüder Benitez – sind nie befragt worden, sie wurden längst selber ermordet. Auch Sperisens Motiv lässt das Bundesgericht offen. Es könne nicht altruistisch gewesen sein, heisst es, ohne dass dies begründet wurde. Eine Begründung fehlt auch in Bezug auf die Strafe von fünfzehn Jahren Gefängnis. Warum nicht zehn oder zwanzig Jahre? Es gibt keine Erklärung, rien de rien.
Die Spuren, die von der guatemaltekischen Staatsanwaltschaft unmittelbar nach der Schiesserei gesichert wurden – zwar in lausiger Qualität, aber immerhin –, weisen auf eine vorsätzliche Tötung der Häftlinge hin. Motive sind viele denkbar. Nicht nur die Polizei, sondern auch die Gefängnisaufseher, die Justiz und die Armee – die Rolle von letzteren beiden wurde nie untersucht – sind in Guatemala tief ins organisierte Verbrechen verwickelt.
Die getöteten Häftlinge standen an der Spitze der Knasthierarchie. Die Gangsterbosse hatten vor der angekündigten Razzia gedroht, die ganze Familie von Vollzugschef Alejandro Giammattei auszulöschen. Wenn man sich in Guatemala auf etwas verlassen kann, dann sind es die Drohungen der Mafia. Sie werden umgesetzt. In Anbetracht der in Guatemala grassierenden Gesetzlosigkeit wäre es naheliegend, dass Giammattei die Gangster umbringen liess, um sich selber und seine Familie zu retten. Doch selbst wenn es so gewesen wäre – was nicht mehr als eine Spekulation ist –, stellt sich immer noch die Frage: Brauchte er dazu die Unterstützung von Erwin Sperisen?
Vielleicht war es ein strategischer Fehler der Verteidiger von Sperisen, die Tötungen an sich in Abrede zu stellen. In einem normalen Prozess, in dem grundsätzlich alles hinterfragt werden muss, wäre es ihre Pflicht gewesen. Doch in diesem politisch befrachteten Fall boten sie damit den Gerichten eine Gelegenheit, der diffizilen und zentralen Frage auszuweichen: Was hatte Sperisen konkret mit diesen Morden zu tun? Auf politischer Ebene mochte er eine Mitverantwortung tragen. Eine Schuld im strafrechtlichen Sinne setzt aber den Vorsatz voraus, ein konkretes Verbrechen zu begehen.
Bertossa-Kollegin als Hauptreferentin
Aus einer geheizten Bürostube in Genf oder Lausanne lässt sich locker darüber spekulieren, was ein Politiker in der brutalen Realität Guatemalas hätte tun oder unterlassen müssen. Den Juristen muss indes klar gewesen sein, dass ihre akademische Akrobatik auf einer politisch kontaminierten Untersuchung baute, deren Gehalt sie nicht überprüfen konnten. Wenn eine Tatversion in sich zusammenstürzte, bastelten sie aus den Trümmern einfach eine neue. Was nicht ins Bild passte, verbannten sie Schritt um Schritt aus den Akten, es existierte damit nicht mehr.
Das Urteil haben die fünf Bundesrichter der Strafrechtlichen Abteilung – zwei Deutschschweizer, zwei Romands, eine Tessinerin – unter dem Vorsitz des Waadtländers Christian Denys zu verantworten. Als Referentin arbeitete sich Richterin Laura Jacquemoud-Rossari ins Dossier ein. Sie verfasste den Entwurf zum Urteil, das von ihren vier Kollegen für gut befunden wurde. Jacqemoud-Rossari hatte in Genf als Staatsanwältin und Richterin Karriere gemacht, nebenbei gibt sie bis heute zusammen mit ihrem ehemaligen Arbeitskollegen Bernard Bertossa die Zeitschrift Semaine Judicaire heraus. Solche Verbindungen sind branchenüblich, doch in diesem aufgeheizten Prozess erweckt eine Richterin aus dem engen und abgeschotteten Genfer Milieu nicht gerade Vertrauen.
Wenn einer der fünf Bundesrichter mit dem Urteil nicht einverstanden ist, muss der Fall öffentlich verhandelt werden. Eine solche Verhandlung gab es im Fall Sperisen nicht. Alle Mitrichter setzten ihren Namen unter das Verdikt ihrer Genfer Kollegin. Neben dem Präsidenten und der Referentin selber waren das Niklaus Oberholzer, Yves Rüedi und Monique Jametti. Hatte wirklich kein einziger dieser Richter Bedenken, womöglich einen Unschuldigen hinter Gitter zu schicken und damit ein Justizverbrechen mitzuverantworten? Oder brachte einfach keiner den Mut auf, Einspruch zu erheben? Es wäre genau der Vorwurf, der nun an Erwin Sperisen hängenbleibt.
(Copyright Weltwoche Ausgabe-Nr. 49/2019, Seite 34)
18. Sperisen kämpft weiter
16. Januar 2020- Kaum hat das Bundesgericht geurteilt, stellt eine Untersuchung aus Guatemala alles wieder auf den Kopf. Die Anwälte des ehemaligen Polizeichefs Erwin Sperisen verlangen eine Revision. Von Alex Baur
Im letzten Dezember bestätigte das Bundesgericht ein Urteil aus Genf, das ratlos macht: Erwin Sperisen, der ehemalige politische Chef der Polizei von Guatemala, soll den Kommandanten Javier Figueroa gedeckt haben, der an einem Gefängnismassaker beteiligt gewesen sein soll. Nur wurde Figueroa – wie alle anderen vermeintlichen Mitverschwörer auf Führungsebene – in exakt derselben Sache im Ausland rechtskräftig freigesprochen. Wie kann man Komplize eines Unschuldigen sein?
Erklären lässt sich das kafkaeske Urteil nur mit einer fatalen politischen Dynamik in Genf. Nachdem Staatsanwalt Yves Bertossa mit dem Segen der Gerichte Sperisen über fünf Jahre lang in Untersuchungshaft hatte schmoren lassen, wäre ein Freispruch für die ganze Genfer Justiz eine Katastrophe gewesen. In enger Kooperation mit der linken Nichtregierungsorganisation Trial, die sein Vater mitgegründet hatte, wollte Bertossa den Guatemalteken eine Lektion in Sachen Justiz erteilen. Bei einem Freispruch hätte man dem dreifachen Familienvater Sperisen, der in seiner Heimat längst als Justizopfer gilt, Schmerzensgeld in Millionenhöhe zahlen müssen.
Wie die Weltwoche am 5. Dezember 2019 aufgrund einer Insider-Indiskretion enthüllte, amtierte in diesem politisch verseuchten Fall die Bundesrichterin Laura Jacquemoud-Rossari als Referentin. Will heissen: Sie allein vertiefte sich in das komplexe Dossier, sie schrieb das Urteil, das von ihren Richterkollegen bloss noch abgesegnet wurde. Doch Jacquemoud-Rossari stammt nicht nur aus Genf, wo sie an der Seite der beiden im Fall Sperisen federführenden Richterinnen Isabelle Cuendet und Alessandra Cambi Favre-Bulle an der Cour de justice das Fundament für ihre Karriere legte. Als langjährige Mitherausgeberin des Juristenblattes Semaine Judiciaire ist sie auch mit dem Bertossa-Clan verbandelt. Eine befangenere Bundesrichterin kann man sich in diesem Fall kaum vorstellen.
Sperisens Anwälte verlangten von Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer umgehend eine Klärung. Er könne zu einem abgeschlossenen Fall leider keine Stellung mehr nehmen, antwortete Meyer mit Schreiben vom 23. Dezember 2019, «aber natürlich steht ihnen der Weg eines Revisionsbegehrens offen». Und genau ein solches Begehren haben die Sperisen-Anwälte Giorgio Campá und Florian Baier diese Woche beim Bundesgericht eingereicht. Sie verlangen, dass die privaten Verstrickungen der Akteure im Fall Sperisen untersucht und offengelegt werden.
Kronzeugen wurden erpresst
Ob das allein reichen würde, ist fraglich. Doch letzte Woche hat das Parlament von Guatemala einen brisanten Untersuchungsbericht veröffentlicht, der mehr als genug Stoff für eine Revision liefert. Gegenstand der parlamentarischen Untersuchung war die internationale Ermittlungsbehörde Cicig, die im Fall Sperisen die Ermittlungen führte. Das Budget der Cicig von insgesamt 167 Millionen Dollar wurde auch von der Schweiz mitfinanziert. Im letzten August wurde die Cicig nach einer Reihe von Skandalen aufgelöst.
Die parlamentarische Untersuchungskommission stellt der Cicig ein vernichtendes Zeugnis aus. Wie aus dem Bericht hervorgeht, hatte sich die Ermittlungsbehörde, bar jeglicher Kontrolle und unter dem Schutz diplomatischer Immunität, zu einer Art Staat im Staat entwickelt. Die zumeist aus der lateinamerikanischen Nachbarschaft stammenden Ermittler erpressten einheimische Richter und Staatsanwälte nach Belieben. Wer nicht nach ihrer Pfeife tanzte, musste damit rechnen, in Handschellen vor laufenden Kameras abgeführt zu werden und für Jahre ohne ordentliche Anklage in einem Untersuchungsgefängnis zu verschwinden.
Die Hauptwaffe der Cicig war die sogenannte colaboración eficaz, eine Art Kronzeugenregelung. Wer ins Fadenkreuz der Ermittler gelangte, konnte wählen: Entweder schwärzte er einen Vorgesetzten an und wurde dafür mit einem kanadischen Arbeitsvisum belohnt – oder er wurde selber öffentlich als Verbrecher vorgeführt und landete für ein paar Jahre im Untersuchungsgefängnis. Weil solche Deals Falschanschuldigungen geradewegs provozieren, sind sie nach Schweizer Recht illegal – und sie waren es auch in Guatemala, zumindest in der Zeit, als gegen Erwin Sperisen und seine vermeintlichen Mitverschwörer Anklage erhoben wurde.
Tatsächlich basiert das ganze Verfahren Sperisen praktisch ausschliesslich auf den vagen Aussagen von solchen Kronzeugen. Bereits vor zweieinhalb Jahren kam der Zürcher Rechtsprofessor und Ständerat (SP) Daniel Jositsch in einem Gutachten zum Schluss, dass die Verwertung der Aussagen von Kronzeugen im Fall Sperisen zwar nicht a priori ausgeschlossen sei (Weltwoche Nr. 22/17, «Aufstand der Rechtsprofessoren»). In einem solchen Fall müssten aber der Inhalt des Deals und die Umstände, unter denen er zustande kam, deklariert und dokumentiert sein. Bekannt ist einzig, dass die zwei im Sperisen-Prozess noch massgeblichen Zeugen mit Strafverschonung und kanadischen Visa belohnt wurden. Gemäss dem Untersuchungsbericht aus Guatemala können es keine sauberen Deals gewesen sein.
(Copyright Weltwoche Ausgabe-Nr. 3/2020, Seite 35)
Das Bundesgericht hat in eigener Sache ein Revisionsbegehren im Fall Erwin Sperisen abgeschmettert. Der einstige Polizeichef von Guatemala wird damit für schuldig befunden, den Kommandanten Javier Figueroa gedeckt zu haben, der sich 2006 an einem Gefängnismassaker beteiligt haben soll. Allerdings wurde Figueroa in derselben Sache in Österreich rechtskräftig freigesprochen. Was gilt nun?
Eine mögliche Erklärung für das widersprüchliche Verdikt liefert die personelle Konstellation. Wie die Weltwoche enthüllte, ist die Genfer Bundesrichterin Laura Jacquemoud-Rossari, die als Referentin das Dossier Sperisen faktisch im Alleingang beherrschte, mit dem Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa verbandelt. Für Bertossa und die Richter, die seine Machenschaften gedeckt hatten, wäre ein Freispruch in diesem politisch verseuchten Prozess eine Katastrophe gewesen. Reparationszahlungen in Millionenhöhe wären fällig geworden. Zum andern war im letzten Januar in Guatemala eine parlamentarische Untersuchungskommission zum Schluss gelangt, dass die Strafermittlungen, auf denen der Sperisen-Prozess fusst, vor Willkür nur so strotzten.
Doch nach Meinung des Bundesgerichtes hielten sich die Verbandelungen von Jacquemoud-Rossari im branchenüblichen Rahmen. Auf den verheerenden PUK-Bericht aus Guatemala trat es aus formellen Gründen nicht ein. Andererseits legt man Wert darauf, Figueroa nicht als Mörder bezeichnet zu haben: «Aus dem erwähnten Urteil geht nicht hervor, dass er [Figueroa] der Haupturheber der Morde gewesen wäre. Man weiss nicht konkret, welche Befehle er genau erteilt hat.» Für Figueroa gelte die Unschuldsvermutung – offenbar aber nicht für seinen angeblichen Gehilfen Sperisen.
Sperisens Anwälte setzen nun alle Hoffnungen auf Strassburg. Immerhin hat sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nicht nur dem Kampf gegen Willkür verschrieben, Ziel ist auch eine internationale Angleichung der Rechtsprechung. Kann sich die Schweiz einfach über einen Freispruch aus Österreich hinwegsetzen? In Anbetracht all der Verbandelungen am unteren Ende des Genfersees wären fremde Richter für einmal bitter nötig.
Copyright die Weltwoche, Ausgabe Nr. 19/2020